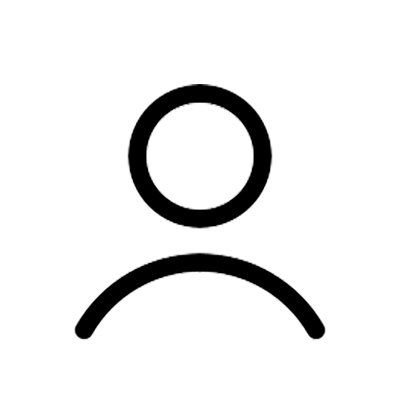Wie Salzburg dunkelrot wurde
- KPÖ Salzburg
Die Barockstadt Salzburg war bisher nicht unbedingt als linke Hochburg bekannt – und schon gar nicht für ihre Affinität zum Kommunismus. Seit kurzem ist das anders. Denn am 10. März gelang der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) hier Historisches. Mit 23,1 Prozent bei den Gemeinderats- und 28 Prozent bei den Bürgermeisterwahlen verzehnfachte sie ihre Mandate auf kommunaler Ebene und ist künftig zweitstärkste Fraktion hinter der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ). Bürgermeisterkandidat Kay-Michael Dankl unterlag zwar in der Stichwahl am 24. März seinem sozialdemokratischen Mitbewerber – erreichte aber mit fast 40 Prozent einen Achtungserfolg und wird Vizebürgermeister.
Ganz aus dem Nichts kam der Erfolg der KPÖ in Salzburg jedoch nicht. Bereits im vergangenen Jahr gelang der Partei mit 11 Prozent der Einzug in den Landtag des Bundeslandes Salzburg, das die Region um die gleichnamige Stadt umfasst. Neben Graz in der Steiermark haben es die österreichischen Kommunisten geschafft, sich in einer zweiten Großstadt als linke Volkspartei zu etablieren – und das zu einer Zeit, in der linke Wahlerfolge in Europa rar geworden sind. Inzwischen wächst die Neugier über das Erfolgsrezept der österreichischen Genoss*innen auch in Deutschland. Zeit, sich die Gründe für das Wiedererstarken der KPÖ in Salzburg etwas genauer anzusehen.
Junge Linke und alte Prinzipien
Die Salzburger Kommunisten haben in den letzten sieben Jahren ein deutliches Mitgliederwachstum verzeichnen können und sind von einer Randerscheinung zur ernstzunehmenden politischen Kraft mit starker gesellschaftlicher Verankerung in der Stadt herangewachsen. Am Anfang dieses Wachstums stand ein politisches Zerwürfnis. Im Frühjahr 2017 kappten die österreichischen Grünen die Verbindung zu ihrer Jugendorganisation – wegen Konflikten mit dem Studierendenverband, nachdem die Jungen Grünen eine alternative grünennahe Studierendenorganisation unterstützen wollten. Die Mitgliedschaft entschied sich daraufhin, sich in „Junge Linke“ umzubenennen und sich politisch neu zu orientieren. In Salzburg entschloss man sich, auf die Kommunisten zuzugehen.
Sarah Pansy war eine der ersten Neuzugänge, als sie vor sieben Jahren in die Salzburger KPÖ eintrat. „Damals bestand die KPÖ in Salzburg aus fünf bis sieben älteren Herren und mir“, erzählt sie. Seit der Landtagswahl im April vergangenen Jahres sitzt sie als eine von vier kommunistischen Abgeordneten im Landtag des Bundeslands und hat den Kommunalwahlkampf in Salzburg mitorganisiert. Ihr ist es wichtig, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen, die ihr in der internationalen Berichterstattung über die Salzburger Kommunisten und ihren Erfolg aufgefallen sind.
„Die KPÖ in Salzburg ist kein Bündnis“, stellt sie klar. Zwar tritt sie hier bei Wahlen als „KPÖ+“ an, damit soll aber nur signalisiert werden, dass die Listen auch für Nichtmitglieder offen sind. Dies bedeutet aber nicht, dass man sich von den Inhalten oder der Strategie der KPÖ auf nationaler Ebene verabschiedet hat. Ganz im Gegenteil: Bemerkenswert ist gerade die Stringenz, mit der die Lektionen aus Jahrzehnten des Parteiaufbaus in Graz auch in Salzburg angewendet wurden.
Auch die neu gewählte KPÖ-Gemeinderätin Roberta Jelinek ist eine der ehemaligen jungen Salzburger Grünen, die sich später der KPÖ angeschlossen haben. Die Voraussetzungen vor Ort waren dafür günstig. „Die Grüne Jugend in Salzburg war schon immer eher links. Dort wurde mehr über Marx und Engels geredet als über Solarpanels“, erklärt sie. „2017, nach dem Rauswurf bei den Grünen, hat der Kay mich angerufen und zu mir gesagt: ‚Wir machen das jetzt gemeinsam.‘“
Roberta Jelinek betont ebenfalls, dass das Politikkonzept der KPÖ personell verstärkt und ausgebaut, aber nicht revolutioniert wurde. Dabei sei der Prozess keinesfalls schnell und reibungslos verlaufen. „Für uns von den Jungen Linken war nicht von Anfang an klar, ob das mit der KPÖ funktionieren würde.“
Vor allem die kulturellen Unterschiede seien zu Beginn mehr als deutlich gewesen. „Da sind zwei verschiedene Welten aufeinandergeprallt“, meint die Kommunalpolitikerin. „Die KPÖ, der wir uns angeschlossen haben, war schon sehr alt, sehr männlich, sehr geprägt durch die Stammtischkultur.“ Die Jungen Linken hätten sich aber nicht durch oberflächliche Andersartigkeiten abschrecken lassen. „Wir haben dann relativ schnell gesehen, dass, wenn man die ganzen Vorurteile einmal beiseite lässt, offensichtlich wurde, dass von der KPÖ ein sehr sinnvoller, erfolgreicher Politikansatz verfolgt wird.“
Heute prägt diese Art, Politik zu machen, die ganze Identität der Partei, alte Streitpunkte sind beigelegt. Die Beschränkung der Gehälter von Mandatsträger*innen und das Angebot von Sprechstunden auf Augenhöhe sind – genauso wie der Einsatz für Frieden und die Neutralität Österreichs oder die Geschichte des kommunistischen Widerstands – Teil des Selbstverständnisses der KPÖ geworden.
Die K-Frage
Diese Einigkeit ist nicht über Nacht entstanden, sondern über Jahre gewachsen, betont Roberta Jelinek: „Es gab viele Diskussionen darüber, ob wir die Partei nicht umkrempeln müssen und ob sie nicht vielleicht einen neuen Namen braucht“, erzählt sie. „Gerade in Salzburg war das ‚K‘ im Namen lange Zeit ein großes Thema, viele waren da sehr vorsichtig. Am Anfang waren nicht alle unbedingt davon überzeugt.“
Inzwischen ist dies aber anders: „Mittlerweile sind wir alle zusammen sehr stolz auf das ‚K‘“. Dafür verantwortlich war auch die Überzeugungsarbeit der Mitgliedschaft der KPÖ: „Die KPÖler fühlten sich von uns nicht vor den Kopf gestoßen oder nicht wertgeschätzt, sie haben uns stattdessen Zeit, Geduld und Vertrauen entgegengebracht, unsere Meinung zu ändern.“
Heute sieht auch Roberta Jelinek den Namen KPÖ als Vorteil. „Ich glaube, das macht es uns einfacher, die Leute anzusprechen, die uns sonst nicht wählen würden“. Das Konzept „Kommunismus“ sieht sie als weniger belastet als den Begriff „Links“. Auch erregt der Name der Partei Aufmerksamkeit. „In Boulevardmedien bekommen wir damit eine relativ große Bühne“, meint die neugewählte Salzburger Stadträtin.
„Unser Name ist tatsächlich ein großer Vorteil für uns“, meint auch Sarah Pansy. „Uns Kommunisten glaubt jeder, dass wir etwas fundamental Anderes wollen.“ Damit erreicht die KPÖ auch Menschen, die mit der Parteipolitik eigentlich abgeschlossen haben. „Ich nehme sehr stark wahr, dass die Menschen, die sich von der Politik ausgeschlossen fühlen, nicht in erster Linie aus moralischen Überzeugungen zur Wahl gehen oder eine Partei aus inhaltlichen Gründen unterstützen, sondern weil sie sich mit einer bestimmten Partei identifizieren. Sie fühlen sich vergessen und ausgeschlossen. Deshalb wählen sie entweder die FPÖ oder uns.“
Inzwischen funktioniert die Zusammenarbeit zwischen alten und neuen Genossen hervorragend. „Wir haben intern ein sehr nettes Klima. Es gibt auch eine gewisse Fehlertoleranz. Es ist in Ordnung, wenn Dinge mal schiefgehen“, berichtet Sarah Pansy.
Damit sich wer ums Wohnen kümmert
Im Wahlkampf setzt die KPÖ vor allem auf ein Thema: die Wohnungsfrage. „Vor allem in Salzburg, aber auch in Innsbruck [wo am 14. April gewählt wird] war das eigentlich klar. Generell ist die KPÖ in Österreich einfach die Wohnen-Partei. Die Mieten sind in den Städten eigentlich überall explodiert“, meint Roberta Jelinek
In der Wohnungsfrage stützt sich die KPÖ auf eine jahrzehntelange Vorarbeit. „Als Ernest Kaltenegger noch alleine für die KPÖ im Gemeinderat in Graz saß, hat er beantragt, dass die Mieten in den städtischen Wohnungen auf ein Drittel des Einkommens der Mieter*innen begrenzt werden sollen“, erzählt Sarah Pansy. „Der Antrag wurde von den anderen Fraktionen natürlich ausnahmslos abgelehnt. Danach hat die KPÖ in der Stadt eine große Kampagne gestartet und 17.000 Unterschriften gesammelt. Es wurde massiv Druck für die Forderung aufgebaut. Am Ende blieb den anderen Parteien nichts anderes übrig, als den Antrag einstimmig zu beschließen.“
Auch in Salzburg wurde die thematische Fokussierung auf die Wohnungsfrage von der KPÖ sehr bewusst und diszipliniert verfolgt. „Damit sich wer ums Wohnen kümmert”, plakatierte die Partei hier. „Egal welches Thema im Rat zu Sprache kam, Kay [Dankl] hat in seinen Reden eigentlich immer zwei Sätze zum Thema Wohnen untergebracht“, meint Sarah Pansy. Der neue Salzburger Vizebürgermeister saß ab 2019 alleine für die KPÖ im Gemeinderat.
„Wir sind gestartet als sehr kleine Partei, mit sehr wenig Ressourcen. Für die Fokussierung auf die Wohnungsfrage gab es deshalb drei Gründe“, erklärt sie. „Sie ist erstens ein großes Problem, das allgemein auch so wahrgenommen wird. Zweitens sind wir als die kleinen Kommunisten gestartet, haben beim Wohnen aber bewiesen, dass wir wirklich relevant sind und wissen, wovon wir sprechen“ so Sarah Pansy. „Wenn man das einmal schafft, dann vertrauen die Leute einem auch irgendwann bei anderen Themen. Aber wir mussten uns wirklich zuerst zu einem Punkt beweisen. Es ist uns gelungen, beim Thema Wohnen immer aufzufallen und inzwischen bekommen wir auch sehr viele Medienanfragen dazu.“
Die Entscheidung war aber keine rein pragmatische: „Der dritte Grund war: Wir sind schon ernsthaft Kommunisten und wir wollen, dass die grundsätzliche kommunistische Kapitalismuskritik für die Leute nachvollziehbar wird. Die Wohnungsfrage ist dafür besonders geeignet. Da versteht wirklich jeder, dass nicht die Profitinteressen im Zentrum stehen sollten, sondern der Mensch, der da wohnt.“
Präsent im vorpolitischen Raum
Mitorganisiert hat den Wahlkampf der KPÖ in Salzburg Georg Kurz. Auch er ist über Umwege zum Kommunismus geraten: In Deutschland war er viele Jahre in der Grünen Jugend aktiv, wurde dort aber politisch immer unzufriedener. Nachdem er die Kampagne „Genug ist genug“ gegen die steigenden Lebenshaltungskosten mitorganisierte, entschloss er sich, die Salzburger KPÖ zu unterstützen und koordinierte dort als Teil eines dreiköpfigen Teams den Wahlkampf.
„Der zentrale Punkt ist Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit. Man darf nicht einfach performativ irgendetwas fordern, und am nächsten Tag irgendetwas anderes“, meint er. Ihre Kernkompetenz beim Thema Wohnen hat sich die KPÖ über Jahre erarbeitet. Hierfür ist der direkte Kontakt zu den Menschen entscheidend – und zwar nicht nur in Wahlkampfzeiten.
„Wir gehen sehr viel in die ärmeren Stadtteile, wo die öffentlichen Wohnungen verfallen und sich niemand kümmert. Wir klingeln an Türen, sammeln Unterschriften, verteilen Flyer an alle betroffenen Haushalte, machen Fotoaktionen für die Zeitung und stellen öffentlichkeitswirksam Anträge dazu. Wir zeigen den Leuten: Wir sind da, wir kümmern uns wirklich darum”, erzählt er. Auch sonst steckt die Partei viel Zeit und Energie in Angebote, die Menschen das Gefühl von Gemeinschaft vermitteln – vielen tatsächlich zum ersten Mal. Die Erfahrungen, die Menschen ohne Anbindung an die Stadtgesellschaft – etwa auf Straßenfesten – machten, seien wichtiger als ideologische Indoktrination. “Wer seine eigene Umwelt noch nie als veränderbar wahrgenommen hat, dem kann man nichts von der Weltrevolution erzählen.“
Die größte Gruppe, die zur KPÖ gefunden hat, sind laut Georg Kurz ehemalige Nichtwähler*innen aus dem ärmeren, dicht besiedelten Norden der Stadt. „Menschen, die von der Stadtpolitik vergessen wurden.“ Die Unterschiede bei der politischen Partizipation waren teils gravierend. „Im Süden haben wir häufig Wahlbeteiligungen von 70 Prozent und mehr, während im Norden eher 30 Prozent die Regel sind.“ In einem Wahlbezirk in unmittelbarer Nachbarschaft des KPÖ-Parteilokals lag die Wahlbeteiligung bei vergangenen Wahlen bei lediglich 18 Prozent, ausgenommen Briefwahlstimmen. „Da ist Demokratie nur noch eine leere Hülle“, meint Georg Kurz.
„Wir sehen Wahlerfolge eher als Strukturtest, der Fokus liegt auf der Zeit zwischen den Wahlen“, erklärt Sarah Pansy. Die Partei führt keinen „Haustürwahlkampf“ im engeren Sinn, sondern klassischen Straßenwahlkampf mit Ständen und Plakaten. „Zuhause bei den Leuten sind wir nicht zur Wahlkampfzeit, sondern eher zwischendurch.“ Die KPÖ bietet in Salzburg ein großes Freizeitangebot, wodurch die Menschen mit der Partei in Kontakt treten können. „Wir sind eigentlich dauerpräsent“, so Sarah Pansy. „Die anderen Parteien werfen uns deshalb oft ‚Dauerwahlkampf‘ vor, aber wir bauen nun mal auf den Kontakt zu den Leuten.“ Hausbesuche finden statt, wenn bestimmte Probleme vor Ort angegangen werden sollen.
Die Arbeit der KPÖ im vorpolitischen Raum ist für den Parteiaufbau entscheidend und wird intern als sehr wichtig angesehen. „Ich persönlich bin vor allem in der Jugendarbeit aktiv“, erzählt Roberta Jelinek. „Wir organisieren Kleiderkreisel, Bastelabende für Mädels, und jede Menge solcher niedrigschwelliger Angebote. Jugendliche, die kein Abitur machen, sondern seit dem 15. Lebensjahr arbeiten, sollen das Gefühl bekommen, dass diese Angebote für sie da sind.“ Das Veranstaltungsprogramm wächst organisch aus der Mitgliedschaft, die ihre eigenen Interessen in die Parteiarbeit mitbringt. „Die Nachbarschaftsküche ist entstanden, weil ein Mitglied einfach Lust hatte, zu kochen“, erzählt die neugewählte Gemeinderätin.
„Wir sind überzeugt, dass Menschen Teil einer Organisation sind, wenn sie Teil einer Gruppe sind“, erklärt Sarah Pansy. Ob Tierfuttermarkt, Lesekreis oder Deutschkurs, all dies gehört zum Angebot der KPÖ. Durch ihre Präsenz vor Ort in den Siedlungen und die Konzentration auf Nichtwähler*innen und Wähler*innen der FPÖ schaffen es die Kommunisten, Menschen zu erreichen, die aus Frust das Interesse an der Politik verloren haben. Auch diese Strategie verfolgt die Partei bewusst. „Weil wir den Rechten die Wähler*innen wegnehmen müssen, wenn wir die Mehrheitsverhältnisse verändern wollen“, so Sarah Pansy. „Wir gehen in Viertel, wo die Einkommen niedrig sind und die Wohnsituation schlecht ist. Wir sind eigentlich ausschließlich im Norden von Salzburg präsent. Wir arbeiten Stadtteil für Stadtteil daran, die Leute zu erreichen und sie zu überzeugen, nicht die Rechten, sondern uns zu wählen. In den Süden, wo die Besserverdiener*innen wohnen, gehen wir eigentlich gar nicht.“
„Wir bekommen trotzdem extrem viele Stimmen von bisherigen SPÖ- und Grünen-Wähler*innen“, erklärt Sarah Pansy. „Nicht, weil wir ihnen sagen, was sie hören wollen, sondern, weil wir sie überzeugen, dass wir etwas verändern können. Wenn man glaubwürdig Politik für Leute macht, die von der Gesellschaft zurückgelassen werden, wird man auch von anderen gewählt. Wir kriegen die Stimmen der Linksliberalen dann auch, weil sie es gut finden, dass wir diese Menschen konsequent vertreten.“
Wie links darf es sein?
Ihre thematische Disziplin bringt der KPÖ aber auch Kritik ein. Der Partei wird vorgeworfen, sie vernachlässige andere Kämpfe und die Interessen von Minderheiten. Sarah Pansy will das nicht auf sich sitzen lassen: „Wir sind eine klar antirassistische Partei. Wir fordern, das Wahlrecht unabhängig von der Staatsbürgerschaft zu machen. Wir akzeptieren nicht, dass große Teile der arbeitenden Bevölkerung vom demokratischen Prozess ausgeschlossen sind. Wir verknüpfen das Thema Migration sehr stark mit der Frage von Demokratie.“
Dennoch ist die Partei sehr bedacht, welche Themen sie nach außen betont. „Wir reden im Wahlkampf nicht so viel über klassisch linke Themen wie Klimaschutz, übers Gendern und über Migration. Wenn wir im Parlament oder auf der Straße dazu gefragt werden, sagen wir aber unsere Meinung dazu,“ meint Sarah Pansy. „Natürlich sind wir auch gegen rechts. Aber wir schreiben nicht auf Plakate ‚Wir sind gegen rechts!‘. Im Zweifel fragen wir uns immer: Nützt das, was wir tun, gerade den Leuten, die davon betroffen sind? 50 bis 80 Prozent der Menschen, die zu uns in die Sprechstunde kommen, haben einen Migrationshintergrund.“
Als Antwort auf die Kritik verweist Sarah Pansy auch auf Wähler*innenstromanalysen. „Für Kommunalwahlen sind sie leider nicht sehr ausgereift, aber eine Forschungsgruppe hat sich für Salzburg trotzdem daran versucht. Man sieht klar: Wir haben den Rechten sehr stark die Stimmen weggenommen, vor allem im Norden. Die FPÖ ist bundesweit in den Umfragen stärkste Kraft, in Salzburg haben sie 12 Prozent.“
Die inhaltliche Disziplin sieht Sarah Pansy als Voraussetzung hierfür: „Wir lassen uns medial gar nicht auf Konflikte mit der FPÖ ein. Unser Hauptfeind ist die [konservative Volkspartei] ÖVP, wir sind einfach die andere Variante des Protests“, meint sie. „Wir haben sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, die uns wählen. Trotzdem machen wir Migration bewusst nicht zum Wahlkampfthema. Wir haben keine Chance, dieses Thema medial zu drehen. Wir geben der FPÖ einfach keine Bühne, es anzusprechen. Und das funktioniert auch. Statt ‚Ausländer raus!‘ plakatierten die Rechten auf einmal ‚Linksruck verhindern!‘, mit einem Motiv mit Hammer und Sichel. Kurz vor der Wahl hat der FPÖ-Spitzenkandidat dann Pappaufsteller mit dem Slogan ‚Ich stehe für günstige Mieten‘ drucken lassen. Mit dieser Aktion haben uns die Rechten in die Hände gespielt“, erzählt Sarah Pansy.
„Wir beziehen uns nicht aktiv auf Kulturkampfthemen. Die Frage ist dann: Hält man es aus, dass die linke Szene das dann nicht besonders gut findet und viele Leute dort nicht die größten Fans von uns sind?“, so Sarah Pansy. „Wir mussten irgendwann akzeptieren, dass Menschen uns nicht so sehr aus Moralvorstellungen wählen, sondern aus Vertrauen.”
Bei 2.500 Euro ist Schluss
Doch hinter dem Erfolg der KPÖ steht mehr als eine sehr bewusste Kommunikationsstrategie. Aufmerksamkeit erreicht die Partei auch durch die interne Regel, dass Mandatsträger*innen ihre Bezüge auf ein Durchschnittsgehalt begrenzen und den Rest in Sozialsprechstunden an Bedürftige abgeben müssen. „Alle Mandatsträger*innen, ob auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, behalten ausnahmslos maximal einen Facharbeiterlohn von ihren Bezügen ein und geben den Rest weiter. Regional abhängig sind das zwischen 2.300 und 2.500 Euro im Monat“, erklärt Sarah Pansy. „Die Sprechstunden machen grundsätzlich nur Mandatsträger*innen. Das ist keine formale Rechtsberatung, wir sprechen einfach von Person zu Person und kümmern uns um die Anliegen der Leute.“
Natürlich kann die KPÖ nicht alle Probleme der Menschen, die in die Sprechstunden kommen, auch lösen, meint Sarah Pansy. „Wir können nicht allen Menschen sofort helfen. Aber wir arbeiten uns in die Themen ein und leisten Unterstützung, so gut wir eben können. Wir sind keine Sozialarbeiterinnen, und finanziell helfen wir den Leuten nur einmalig und kommunizieren das auch offen“, erklärt sie.
Mit den Hilfsgeldern geht die KPÖ sehr bewusst um: „Solange es irgendwo eine andere Stelle gibt, verweisen wir die Leute darauf. Wir geben nur Geld, wenn sonst nichts mehr geht. Wenn Leute ein zweites oder drittes Mal zu uns kommen, haben wir Gutscheine für Lebensmittel. Bei der finanziellen Unterstützung geht es meist um Summen von 80 bis 150 Euro. Aus rechtlichen Gründen erfolgt die Abgabe der Gelder durch uns als Privatpersonen, wir können das nur mit unseren eigenen Gehältern machen, nicht mit Mitteln der Partei. Über die Verteilung entscheiden wir als Mandatsträger*innen selbst. Es gab in all den Jahren aber noch nie einen Konfliktfall oder eine strittige Entscheidung.“
Sarah Pansy hört oft Bedenken von anderen Linken, in den Sprechstunden müsse man die Erwartungen der Menschen enttäuschen. Diese hält sie für unbegründet. „Das ist gar nicht das Mindset, mit dem die Leute kommen. Menschen verstehen es sehr gut, wenn man sagt, dass man sich informieren muss oder ihnen nicht weiterhelfen kann. De facto kennen wir alle Leute in Sozialeinrichtungen und Kirchen, bei der Caritas und der Wohnungslosenhilfe. Von dort aus werden die Leute häufig weiter zur KPÖ geschickt, weil wir ihnen unkompliziert helfen können. Dadurch sammelt sich sehr viel Knowhow bei uns. Auch sind bei uns sehr viele Beschäftigte von sozialen Einrichtungen politisch aktiv“, erläutert sie.
Anders als die politische Konkurrenz begreift die KPÖ die Sprechstundenarbeit als integralen Teil ihres Auftrags. „Wir haben angefangen, die Sprechstunden direkt im Schloss Mirabell, dem Sitz der Stadtverwaltung, zu machen. Es kommen eigentlich die ganze Zeit Leute, auch unangekündigt, wenn wir mal nicht da sind. Es ist jetzt öfter passiert, dass die Leute dann links und rechts bei den anderen Parteien geklopft haben, vor allem bei der SPÖ und den [liberalen] Neos. Irgendwann kamen sie zu uns und meinten: ‚Könnt ihr bitte damit aufhören, die Leute klopfen bei uns und wir wissen nicht, was wir mit ihnen tun sollen.‘ Wir haben ihnen gesagt, sie sollen eben ihren Job machen und ihnen helfen“, erzählt Sarah Pansy.
Die Sprechstunden sind transformativ für das Verhältnis der Partei zu den Wähler*innen: „Menschen machen zum ersten Mal in ihrem Leben die Erfahrung, dass sie von der Politik ernst genommen werden, und dass sich dadurch etwas ändert. Das gibt uns eine massive Glaubwürdigkeit, weil die Leute gewohnt sind, zu den Kommunisten zu kommen“, meint Georg Kurz. „Das ist unsere Arbeit, sich genau damit auseinanderzusetzen. Aus der Summe all dieser Probleme leitet sich erst ab, was sich ändern muss in der Stadt.“
Auch Sarah Pansy hält das Konzept der Gehaltsbegrenzung, verbunden mit der direkten Erreichbarkeit der Mandatsträger*innen, für entscheidend für den Erfolg der KPÖ: „Wir halten Karrieristen aus der Partei fern und bleiben bodenständig. So sorgen wir dafür, dass bei uns Menschen Mandate übernehmen, die aus Überzeugung Politik machen und nicht für Geld.“
Die konsequente Gehaltsbegrenzung dient der Partei auch als Alleinstellungsmerkmal. „Wir werden die ganze Zeit darauf angesprochen“, so Sarah Pansy. Auch die Arbeit der Abgeordneten ist geprägt von diesem Ethos. „Es macht etwas mit uns Abgeordneten, im ständigen Kontakt mit den Menschen zu stehen. Man vergisst nicht, für und mit wem man Politik macht.“ Umgekehrt erfahren Menschen dort zum ersten Mal, dass sich die Politik tatsächlich ihrer Alltagsprobleme annimmt. „Für viele Leute ist das tatsächlich ein erster Schritt in die politische Debatte. Viele Menschen, die zu uns kommen, haben kein Wahlrecht, haben das Vertrauen in die Behörden verloren oder gehen gar nicht mehr wählen. Wir leisten hier auch sehr basale Demokratisierungsarbeit.“
Die Dialog- und Hilfsangebote der KPÖ will Sarah Pansy auch nicht als Beiwerk zur inhaltlichen Arbeit verstanden wissen. „Wir nehmen aus den Sprechstunden Ideen und Anregungen für unsere Anträge im Landtag und im Gemeinderat mit. Unsere Sprechstundenarbeit hebt sich dadurch von der Charity-Politik der anderen Parteien ab.“
Für die sonstigen Mitarbeiter*innen der KPÖ, die kein Mandat ausüben, ist die Abgabe der Gehälter freiwillig. „Bei uns gibt es einen Kollektivvertrag [Tarifvertrag]. Teilweise sind die Leute auch bei der Kommune oder beim Land angestellt und erhalten entsprechende Bezüge“, so Sarah Pansy. „Ich habe Mitarbeiter, die verdienen mehr als ich. Ob man sich als Mitarbeiter*in an die Gehaltsgrenze hält, ist eine individuelle Entscheidung, da wird auch kein Druck ausgeübt.“
Zukunftspläne
Momentan ist der Erfolg der KPÖ noch ein im Wesentlichen urbanes Phänomen. Doch die Partei will sich nicht mit ihrer Präsenz in den Großstädten zufriedengeben. Auch in kleineren Gemeinden strebt die Partei den Aufbau von Strukturen an und ist mancherorts bereits fest etabliert: Bei den jüngsten Kommunalwahlen konnte die Partei auch in zwei Gemeinden im Salzburger Umland, in Hallein und Wals-Siezenheim, Gemeinderatssitze gewinnen.
„In Wals-Siezenheim ist vielen gar nicht bewusst, dass sie nicht in Salzburg wohnen, die Gemeinde schließt unmittelbar an das Stadtgebiet an“, erklärt Roberta Jelinek. „Sie ist industriell geprägt und konservativ. Wir haben dort keine eigenständigen Parteistrukturen, das geht ineinander über.“
Im etwa zehn Kilometer entfernten Hallein, der zweitgrößten Gemeinde im Bundesland, ist man etwas weiter. „Dort hat sich eine etwas größere Gruppe gefunden“, erzählt Roberta Jelinek. „Wir werden auch dort bald Sozialsprechstunden anbieten und es gibt eine Jugendgruppe. Wir versuchen, das Konzept aus Salzburg zu importieren. Ich habe dort Flyer verteilt, und es hilft uns sehr, dass wir dort eine sehr gute Kandidatin hatten. Karin Lindorfer ist Lehrerin, jeder kennt sie und weiß, dass sie ein sehr integrer Mensch ist und sie ihre Kinder sehr gut unterrichtet.“
Die Partei hat durchaus Ambitionen für den ländlichen Raum, wie Sarah Pansy erklärt. „Wir haben unsere Kräfte gebündelt und gehen jetzt Stück für Stück an, Strukturen aufzubauen und dabei von den Ballungsräumen ausstrahlen.“ In Innsbruck stehen am 14. April Kommunalwahlen an. Noch ist die KPÖ dort längst nicht so präsent wie in Salzburg oder in ihrer Hochburg Graz in der Steiermark, wo die Kommunistin Elke Kahr seit 2021 als Bürgermeisterin regiert. Doch die Partei hat die Absicht, auch hier Fuß zu fassen.
Sorgen, dass der Wahlerfolg die KPÖ verändern oder korrumpieren könnte, haben die jungen Kommunisten nicht. „Wir haben alle großen Respekt vor der Aufgabe“, meint Sarah Pansy. In Salzburg gibt es, genau wie in Graz, auf kommunaler Ebene eine Proporzregierung. Kay-Michael Dankl wird also auf jeden Fall Vizebürgermeister. Anders als in Graz wird es jedoch keine informelle Koalition links der Mitte geben, denn in Salzburg sind traditionell alle im Stadtrat vertretenen Parteien auch tatsächlich an der Regierung beteiligt. „An uns kommt man nun nicht mehr vorbei, das ist eine neue Situation für uns“, so Georg Kurz.
Die Salzburger SPÖ gilt als konservativ und ist dominiert vom Parteiflügel um Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann des Burgenlands, der dort bis 2020 in einer Koalition mit der rechtsextremistischen FPÖ regierte. Gedanken darüber, von der Sozialdemokratie vereinnahmt zu werden, muss sich die KPÖ in Salzburg also eher nicht machen.
Ein Vorbild für anderswo?
Der Erfolg der KPÖ in Salzburg und Graz wirft die Frage auf, ob linke Parteien in anderen Ländern davon lernen könnten. Bezogen auf die Situation in Deutschland gibt es zwar Unterschiede, Sarah Pansy schätzt diese aber als nicht allzu gravierend ein: „Die Themenlage in Österreich unterscheidet sich nicht wesentlich von der in Deutschland. Auch die Unterschiede im politischen System sind eher gering.“ Die Wohnungsfrage ist in Deutschland ähnlich dringlich wie in Österreich.
Bei anderen Themen hat man es dort aber leichter, räumt Sarah Pansy ein. „Die österreichische Debatte über Krieg und Frieden ist für uns sehr viel einfacher. Wir haben die gleiche Position wie die Linkspartei in Deutschland: Wir sind gegen den Angriffskrieg in der Ukraine und verurteilen ihn auch. Wir sind gegen Waffenlieferungen und für Frieden. Aber realpolitisch ist das für uns deutlich einfacher zu manövrieren, weil die Zustimmung zur Neutralität Österreichs bei 60 bis 90 Prozent liegt. Sehr vereinzelt wird sie zwar infrage gestellt, aber das ist die absolute Ausnahme.“ Doch obwohl das Thema in Österreich von geringerer tagespolitischer Relevanz ist, wird die KPÖ wegen ihrer Position in der Friedensfrage trotzdem mitunter angefeindet: „Was vorkommt, ist, dass wir in die Putin-Ecke gestellt werden. Uns wird dann einfach so unterstellt, wir hätten Kontakte zu Putin, was definitiv nicht stimmt.“
Hinsichtlich der parteiinternen Organisation gibt es bei der KPÖ aber durchaus gewichtige Unterschiede zu anderen europäischen Linksparteien und auch zur Partei Die Linke in Deutschland. So wird etwa die Aufnahme von Neumitgliedern in Österreich deutlich restriktiver gehandhabt. Während in Deutschland in vielen Landesverbänden der Beitritt per Online-Formular möglich ist, besteht die KPÖ auf einer längeren Phase des Kennenlernens.
„Wir nehmen so gut wie nie Mitglieder auf, die seit weniger als drei Monaten dabei sind“, erklärt Sarah Pansy. „Potentielle Neuzugänge werden zu einer offenen Mitgliederversammlung eingeladen und bekommen einen Crashkurs zur Parteiorganisation. Erst im Anschluss findet ein Mitgliedsgespräch statt. Bei uns gibt es aber keine Ideologiechecks, das Soziale muss passen. Manche Leute entscheiden sich wegen gegensätzlicher Positionen in Einzelpunkten, etwa zur Friedensfrage, auch dazu, nicht Mitglied zu werden, arbeiten aber trotzdem bei einzelnen Projekten mit. Für uns ist das vollkommen in Ordnung.“
„In jedem Fall ist Mitglied werden bei uns aber ein längerer Prozess“, erklärt Sarah Pansy. „Wer bei uns beitreten will, muss sich auch mit der Geschichte des Kommunismus auseinandersetzen, inklusive der Verbrechen des Stalinismus. Das ist auch notwendig, denn die Leute stehen unter einem hohen externen Rechtfertigungsdruck. Sie werden dauernd gefragt, wieso sie zu den Kommunisten gehen und müssen erklären können, warum.“ Die gut etablierten Strukturen und Prozesse hierfür sind aber auch der Grund dafür, warum sie sich über die Einbindung der zahlreichen Neuzugänge keine Sorgen macht. Denn seit sie zur KPÖ kam, hat sich die Zahl der Mitglieder in Salzburg auf etwa 70 verzehnfacht, hinzu kommen etwa 150 Freiwillige.
Gut möglich, dass nach dem Wahlerfolg der KPÖ in Salzburg diese Zahlen sehr bald nochmals deutlich übertroffen werden könnten. Und die fünf bis sieben älteren Herren? „Einer der Genossen ist leider vor kurzem verstorben“, berichtet Sarah Pansy. „Aber die anderen machen mehr als je zuvor.“ In Salzburg haben es alte und junge Kommunist*innen gemeinsam geschafft, zusammenzufinden und ihre Partei vom Rand in die Mitte der Gesellschaft zu bewegen.