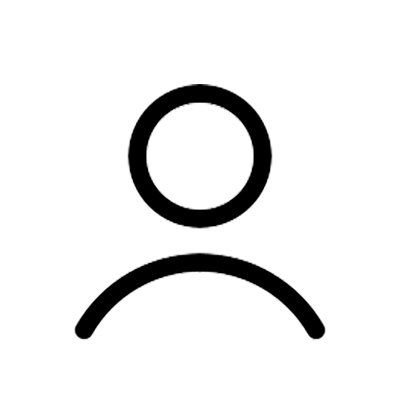Ja, nur nicht bei mir: Nimbyismus als Herausforderung für Verkehrs- und Energiewende
Wer sich mit der Frage der Umsetzung der Energiewende oder der Verkehrswende vor Ort beschäftigt, wird schnell auf das Problem des Nimbyismus stoßen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien oder dem Schienennetzausbau werden im Allgemeinem nicht abgelehnt – aber im Speziellen. Die dafür nötige Infrastruktur soll, nach dem Willen der Nimbys, bitte woanders gebaut werden. Dieser politische Essay verwendete drei verschiedene theoretische Ansätze, um eine Position zu dem Problem des Nimbyismus zu entwickeln; einen an der Spieltheorie orientierten Ansatz aus der modernen politischen Philosophie und Politikwissenschaft, Elemente der Entfremdungstheorie von Rousseau und Marx, sowie, als drittes, einen Ansatz der Verteilungsgerechtigkeit, der sich ebenfalls an Marx anlehnt. Insbesondere der dritte Ansatz macht die Positionierung eindeutig. Eine linke Partei, die beansprucht die Interessen der Menschen mit geringen Einkommen und die Interessen der zukünftigen Generationen zu vertreten, braucht eine klare Linie gegen den Nimbyismus. Der erste Ansatz hilft jedoch dabei, zu verstehen, wie die eigene Argumentation in solchen Debatten aufgebaut sein kann, und der zweite Ansatz erklärt, wieso noch so gute Argumente die entschiedenen Nimbys leider nicht überzeugen werden.
Die Struktur der Debatten mit Nimbys
Die zwei konkreten Debatten, an denen mir die Herausforderung klar geworden ist, die der Nimbyismus für die Verkehrs- und Energiewende darstellt, sind die um die Gleichstrom-Höchstspannungstrassen und die Neubautrassen der Bahn. Diese Stromtrassen werden inzwischen unterirdisch geplant, und stören deswegen meistens nicht mehr die Landschaft, aber dort, wo mehrere Trassen verbunden werden sollen, ist der bei Bau eines „Gleichstrom-Drehkreuz“ mit 30 Meter hohen Industriehallen erforderlich. Ein dieser sog. „Multiterminal-Hub“ soll nach den letzten Planungen im Südwesten der Region Hannover gebaut werden, wo sich mehrere diese unterirdischen Stromtrassen kreuzen.
Zunächst war ein Standort in der Nähe der kleinen Ortschaft Redderse im Gespräch, einem Dorf, in dem man sowie eher unzufrieden mit der Lokalpolitik ist: es fehlen Fahrradwege, der Bus kommt sonntags nur alle 2 Stunden und bei dem Starkregenereignissen im Dezember wurden einige Keller überflutet, weil die Entwässerung des Dorfgebietes offenbar unzureichend ist. Diese Probleme konnten die Einwohnenden aber nicht so mobilisieren, wie die Ankündigung des Multihub. Die Plakate dagegen sind immer noch an den Zäunen von Grundstücken in der Kommune zu sehen sind.
Das zweite Beispiel für Nimbyismus im Westen von Hannover ist die Debatte um die Neubautrasse Hannover-Bielefeld der Deutschen Bahn. In den betroffenen Ortschaften Barsinghausens haben sich Bürgerinitiativen dagegen gebildet, die kleine Demonstrationen organisiert haben; lokale Landtagsabgeordnete der SPD und ein Bundestagsabgeordneter der CDU haben sich gegen die Neubautrasse ausgesprochen und befürworten stattdessen den Ausbau der Bestandstrasse.
Hier wiederholt sich ein Muster, dass sich bereits in der Diskussion um die sog. Y-Trasse, zwischen Bremen/Hamburg und Hannover, gezeigt hat. Die Deutsche Bahn plant diese seit 30 Jahren um die Hinterlandanbindung der Nordseehäfen zu verbessern. Die Y-Trasse wird jedoch seit Jahrzehnten politisch verzögert und blockiert, weil dann wohlhabende Hamburger Vororte wie Seevetal wesentlich stärker vom Schienenverkehr betroffen wären; stattdessen soll die Bahn die Bestandstrecke Hamburg-Hannover ausbauen, wodurch jedoch nur geringe Kapazitätssteigerungen erreicht werden können.
Solche Debatten verlaufen immer nach einem ähnlichen Muster. Das Akronym Nimby steht für: „Not In My Backyard“. Die Präferenzen eines Nimbys lassen sich also folgendermaßen beschreiben:
- Infrastruktur wird gebaut, aber nicht bei mir.
- Infrastruktur wird gar nicht gebaut.
- Infrastruktur wird bei mir gebaut.
Damit lässt sich das Problem des Nimbyismus als eine Gefangendilemma-Situation analysieren, und es handelt sich um das gleiche Problem, wie es auch bei der Frage der Finanzierung der Infrastruktur auftritt, das ich in einem früheren Essay thematisiert hatte.
Die dort skizzierte Lösung, die Jean Hampton allgemein für die Bereitstellung öffentliche Güter vorgeschlagen hat, lässt sich auch auf das Problem des Nimbyismus anwenden: Alle Menschen ein langfristiges Interesse daran, dass öffentliche Infrastruktur gebaut wird und funktioniert; die beide letzten Präferenzen sind also vertauscht (die Präferenz: "Infrastruktur wird bei mir gebaut" ist größter als die Präferenz: "Infrastruktur wird gar nicht gebaut"). Damit sie sich über ihre wahren Interessen klar werden, bedarf es jedoch sogenannter "politischer Unternehmer", die ihnen diese vor Augen führen. Diese politischen Unternehmer können Politikerinnen und Politiker sein, Aktivistinnen und Aktivisten, oder auch, in den hier untersuchten Fällen, die Fachleute jener Konzerne und Behörden, welche die Infrastruktur betreiben, und vor Ort in Dialogveranstaltungen erklären.
Visionen für die Verkehrswende
Der abstrakte Begriff des "langfristigen Interesses" lässt sich konkret an der Verkehrswende illustrieren. Neubautrassen für den Schienenverkehr sind in Deutschland auch deswegen erforderlich, weil sich hier die Hochgeschwindigkeitszüge oft die Gleise mit anderen, langsam fahrenden Zügen teilen. Züge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf den gleichen Gleisen fahren zu lassen, benötigt jedoch deutlich mehr Kapazität, weswegen sich die Kapazität einer Strecke durch den Bau einer Hochgeschwindigkeitstrasse mehr als verdoppeln lässt. Die zusätzlichen Kapazitäten, die durch den Bau einer Neubaustrecke frei werden können, sind dann für den Güterverkehr und Regionalbahnen erforderlich.
Die Bedeutung von Regionalverkehr und S-Bahnen für den Berufsverkehr der Großstädte sollte offensichtlich sein; eine Regionalbahn, S-Bahn oder U-Bahn kann, mit entsprechend vielen Wagons und Stehplätzen, durchaus 1000 Menschen transportieren – dafür braucht man, bei durchschnittlich 1,2 Passagieren pro PKW, 834 Autos. Deswegen brauchen Großstädte ab einer bestimmten Bevölkerungszahl einen schienengebundenen ÖPNV (der subventioniert werden muss), ansonsten übersteigt die Zahl der Pendler mit dem Auto im Berufsverkehr bei weitem die Kapazität jedes vernünftig dimensionierten Straßennetzes. Dies ist auch im Interesse derjenigen, die dann weiterhin mit dem Auto fahren, weil damit die Zahl der Autos auf den Straßen insgesamt abnimmt.
Durch die Schaffung von mehr Kapazitäten für den Schienengüterverkehr lassen sich die Autobahnen entlasten: Ein Güterzug kann 52 LKWs ersetzen; das heißt im Übrigen auch, dass im Fernverkehr ein Lokführer 52 Berufskraftfahrer ersetzen kann. Die ist ein entscheidender Vorteil: Die Arbeit im Fernverkehr ist verständlicherweise unbeliebt, weil man dabei nachts nicht mehr nach Hause kommt und in Pensionen übernachten muss; außerdem herrscht Fachkräftemangel bei LKW-Fahrer/innen.
Im Schienengüterverkehr werden Ganzzugverkehr, Einzelwagenverkehr und der Kombinierte Verkehr unterschieden. Die ersten beiden erfordern Betriebe mit einem eigenen Gleisanschluss, der Kombinierte Verkehr intermodale Terminals, bei denen Container (bzw. Wechselbrücken oder Sattelaufleger) zwischen Schiene, LKW und ggf. (Binnen-)Schiff ungeladen werden können. Ab ca. 600 km ist der Kombinierte Verkehr kosteneffektiver als eine direkte Fahrt mit dem LKW, und weil keine eigenen Gleisanschlüsse erforderlich sind, ist der Ausbau des Kombinierten Verkehrs die beste Möglichkeit, Güter auf die Schiene zu verlagern. DB Cargo und die in der Kombiverkehr KG organsierten Spediteure haben seit 2021 den Plan eines „Metro-Net“, bei dem die bestehenden Terminals ausgebaut und ergänzt werden sollen.
Es gibt noch wesentlich ambitioniertere Visionen für den Ausbau des Schienengüterverkehrs (z.B. im Wahlprogramm der Linken. Niedersachsen 2022). Theoretisch kann der Transport mit einem Güterzug (bei 120 km/h) sogar schneller sein als mit dem LKW; dies setzt aber voraus, dass der Güterzug nicht verlangsamt wird, um Personenzügen Platz zu machen, die Vorrang haben. Die Visionen und Pläne dafür, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern, setzen einen entsprechend umfassenden Ausbau des Schienennetzes voraus.
Helmut Schmidt wird der Satz zugeschrieben: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“ – Aber wie soll in einer Demokratie der Bau öffentlicher Infrastruktur sonst beschlossen werden? Man braucht nicht nur einen Plan zum Ausbau der Infrastruktur, sondern dieser muss auch in einer Weise präsentiert werden, dass der Mehrheit der Menschen klar wird, wieso dieses Projekt in ihrem langfristigen Interesse ist! Auch der Deutschlandtakt für den ICE ist im Übrigen eine solche Vision, der das Umsteigen vereinfachen würde und damit die Reisezeiten mit Hochgeschwindigkeitszeugen deutlich reduzieren würde. Aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit (s.u.) denke ich jedoch, dass dieser eine geringe Priorität haben sollte als die Verlagerung von Gütern auf die Schiene.
Die technologischen Fragen der Energiewende
Vergleichbare Überlegungen gelten für Infrastrukturprojekte im Rahmen der Energiewende. Auch hier braucht es eine gesellschaftliche Vision, um eine Mehrheit für den Bau der Infrastruktur zu gewinnen! Dabei ist es sinnvoll, Verkehrswende und Energiewende begrifflich zu unterscheiden. Bei der Verkehrswende geht es darum, die Probleme, welche durch die Autoverkehr entstehen, zu beheben. Dazu zählt insbesondere der Platzbedarf für Pkws und Lkws, aber auch die hohe Zahl von Verkehrstoten. Bei der Energiewende hingegen geht es darum, die Gesellschaft auf eine Energieversorgung umzustellen, die nicht in eine absehbare Klimakatastrophe führt! Es ist klar, dass dafür der Verbrennungsmotor (zumindest betrieben mit fossilen Treibstoffen) ausrangiert werden muss, aber auch wenn wir in Zukunft alle mit E-Autos fahren, dann wird der Stau in Großstädten und auf den Autobahnen dadurch nicht weniger.
Die Energiewende hat eine höhere Priorität als die Verkehrswende. Wenn wir in 30, 60 oder 100 Jahren immer noch im Stau stehen, dann wäre das zwar nicht schön, aber sicherlich keine Katastrophe; wenn wir hingegen nicht die Energiewende nicht schaffen, dann steuern wir direkt in eine Klimakatastrophe zu. Im Rahmen der Vereinten Nationen hatten sich die Staaten der Erde 1997 in Paris darauf geeinigt, die Erwärmung auf maximal 2 °C zu begrenzen, idealerweise auf 1,5 °C. Wie schwierig es sein wird, dieses Ziel zu erreichen, lässt sich aus dem Bildungswiki Klimawandel entnehmen.
Zu den mittelfristig katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels für Europa zählen insbesondere viel häufigere Hitzewellen und Starkregenereignisse sowie eine Änderung der Klimazonen. Die zu befürchtende Änderung der Klimazonen ist im Übrigen der Grund, wieso der Artenschutz kein Argument gegen Windkraftanlagen und andere Infrastrukturprojekte ist. Die Störung und der Verlust an Biotopen durch den Klimawandel sind deutlich größer, als dies durch die Infrastruktur für die Energiewende der Fall ist.
Langfristig katastrophal ist der zu erwartende, starke Anstieg des Meeresspiegels. Die wirkliche Katastrophe jedoch wäre das Erreichen bestimmter Kipppunkte, ab dem das Weltklima praktisch irreversibel zu einem „Treibhaus Erde“ (Hothouse Earth) wird, mit einem Temperaturanstieg von 6°C oder mehr – ein Klima, welches auf der Erde zuletzt vor 60 Millionen Jahren existierte. Die empfehlenswerte Doku Climate Extremes auf Youtube (Untertitel in Deutsch verfügbar) bietet dazu ein Interview mit Johan Rockström, dem Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der betont, dass einige dieser Kipppunkte vielleicht schon bei einem Temperaturanstieg von 1,5 °C erreicht werden.
In Anbetracht dieser Gefahren sollte jedem klar werden, wieso es dringend erforderlich ist, das Ziel der Klimaneutralität möglichst schnell zu erreichen. Dabei ist die Erzeugung von Elektrizität mit Solar- und Windkraft keine technologische Herausforderung mehr.
- Bildungsserver.de / Deutsches Klimarechenzentrum
- CC BY-NC-ND 4.0
Die hohen Kosten der Atomkraft sind im Übrigen ein Grund, wieso der Bau neuer Kernreaktoren kein Beitrag zur Energiewende ist – völlig unabhängig von den Risiken der Atomkraft und der Frage der Endlagerung ist es effektiver, das Geld in Wind und Solar zu investieren. Der Bericht, aus dem die Grafik entnommen ist, fasst die Dynamik der Innovation zusammen, durch die der Preis von Solarmodulen exponentiell gesunken ist. In den 1960ern und 70ern war Solar eine Nischentechnologie für den Weltraum und abgelegene Orte ohne Anschluss an das Stromnetz. Der sinkende Preis führte dann jedoch zu einer steigenden Nachfrage, was wiederum zu Fortschritten in der Produktionstechnologie für Solarmodule und damit zu weiter sinkenden Preisen führt – ein sich selbst verstärkender Kreislauf.
Die gleiche Innovationsdynamik ist bei Batterietechnologie zu beobachten. Solar- und Windenergieanlagen haben zwar gegenüber Kohle und Atomenergie den Vorteil, dass ihre Energieerzeugung nicht umweltschädlich Ressourcen verbrauchen, aber ihre Leistung ist natürlich von Sonnenschein und Windstärke abhängt. Um diese Variabilität von Solar und Wind zu kompensieren sind einerseits Pumpspeicherwerke, Batterien und andere Formen von Energiespeichern erforderlich, andererseits ein weiträumiges Hoch- und Höchstspannungsnetz, das Elektrizität von Orten mit Sonnenschein und hohen Windstärke dahin transportieren kann, wo sie gebraucht wird.
Die Vision hinter dem Bau der "Stromautobahnen" wie SuedLink beschreib das zuständige Ministerium so: „[…] der erneuerbare Strom aus Windenergie vorrangig im Norden und Osten sowie auf See erzeugt, wo der Wind besonders stark weht. Die größten Stromverbraucher - allen voran große Industriebetriebe - befinden sich aber im Süden und Westen Deutschlands. Der im Norden erzeugte „Windstrom“ muss also dorthin transportiert werden. […] Bis Mitte April 2023 werden auch die letzten noch laufenden drei deutschen Kernkraftwerke außer Betrieb genommen – und auch andere konventionelle Kraftwerke werden schrittweise stillgelegt. Diesen Wandel zeichnet auch das Stromnetz nach: Nach aktuellem Stand müssen in den nächsten Jahren insgesamt über 13.000 Kilometer im Übertragungsnetz optimiert, verstärkt oder neu gebaut werden. Eine besondere Rolle spielen hierbei die Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen (HGÜ-Leitungen), die sogenannten Stromautobahnen, wie beispielsweise ‚SuedLink‘ oder ‚SuedOstLink‘“ (Quelle).
Es wäre aber auch eine dezentrale Energiewende denkbar, bei der mehr Elektrizität vor Ort erzeugt und gespeichert wird, und dadurch weniger Stromautobahnen erforderlich sind. Wir hatten als Ortsverband Die Linke Hannover-Südwest dazu einmal den Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert als Referent eingeladen. Und es gibt noch eine dritte Option. Überflüssiger Wind- oder Solarstrom lässt sich zur Herstellung von Wasserstoff durch die Elektrolyse von Wasser nutzen, und, mit CO2 aus der Luft, dann zur Synthese von Methan und anderen energiereichen Kohlenwasserstoffen (sog. E-Fuels). Methan lässt sich in das bestehende Fernleitungsnetz für Erdgas und die damit verbundenen Speicher einspeisen, und auch für Wasserstoff plant die European Hydrogen Backbone initiative (EHB) ein Fernleitungsnetz. Der Energieverlust, wenn man Ökostrom erst in Wasserstoff umwandelt, und danach wieder in Elektrizität, ist jedoch immens und beträgt über 50 Prozent. Außerdem werden synthetisch hergestellte E-Fuels vor allem benötigt, um den CO2-Ausstoß von Flugverkehr und Schifffahrt zu reduzieren.
Die Vision für die Energiewende bleibt also, anders als bei der Verkehrswende, im Detail unklar. Der Bau von Stromautobahnen ist sicher erforderlich, aber es ist nicht klar, welchem Umfang diese annehmen müssen, und ob die Energiewende nicht auch zu einem großen Teil dezentral erfolgen kann.
Der Nimby als Bourgeois
Ob sich als Kommunalpolitiker der Aufwand lohnt, sich sehr intensiv mit den technologischen Fragen der Energiewende zu beschäftigen, ist jedoch schwer einzuschätzen. Zum einem ist nicht absehbar, wie groß die Fortschritte in der Batterietechnologie sein werden. Je geringer die Kosten und der Platzbedarf der Energiespeicher, desto dezentraler ließe sich die Energiewende gestalten. Zum anderen besteht in meiner Erfahrung kein großes öffentliches Interesse an der Beschäftigung mit diesen technischen Details. Für die erwähnte Veranstaltung mit Ralph Lenkert zum dem Thema Stromtrassen hatte ich Flyer in einer der Dörfer verteilt, die direkt von der Stromtrasse SuedLink betroffen sind. Trotzdem ist niemand gekommen.
Sollten in einer Demokratie nicht alle Bürgerinnen und Bürger ein Interesse haben, sich ausführlich über ein wichtiges Thema wie die Energiewende zu informieren? Dem Anspruch nach schon: Rousseau beschreibt dieses Problem durch die Unterscheidung von Sonderwillen und Gemeinwille: „In der Tat kann jedes Individuum als Mensch einen Sonderwillen haben, der dem Gemeinwillen, den er als Bürger (Citoyen) hat, zuwiderläuft oder sich von diesem unterscheidet. Sein Sonderinteresse kann ihm anderes sagen als das Gemeininteresse; sein selbstständiges und natürlicherweise unabhängiges Dasein kann ihn das, was er der gemeinsamen Sache schuldig ist, als eine unnütze Abgabe betrachten lassen, deren Einbuße den anderen weniger schadet, als ihn ihre Leistung belastet […] eine Ungerechtigkeit, deren Umsichgreifen den Untergang der politischen Körperschaft verursachen würde.“ Wenn die Menschen nur ihren Sonderwillen folgen, und nicht dem Gemeinwillen, dann kann eine Republik keinen Bestand haben. In einer Fußnote zum Begriff ‚Republik‘ beschreibt Rousseau diesen Gegensatz auch durch die Unterscheidung von Citoyen und Bourgeois. Der wahre Sinn des Worte ‚cité‘ ist für Rousseau bei den neueren Philosophen fast völlig verschwunden. Die meisten verwechseln, so Rousseau, Stadt (ville) und Republik (cité), Städter (bourgois) und Bürger (citoyen), und wissen nicht, dass die Häuser die Stadt, die Bürger aber die Republik ausmachen.
Für die politische Philosophie ist diese Unterscheidung zwischen Citoyen und dem Bourgeois interessant, weil sie später bei Hegel findet, und dann auch bei Marx. In einer der frühen Schriften, in Band I der Marx-Engels-Werke, geht es Marx vordergründig um den Stellenwert der Religion, dahinter verbirgt sich eine anspruchsvolle These über die Entfremdung in der bürgerlichen Gesellschaft: „Die Differenz zwischen dem religiösen Menschen und dem Staatsbürger ist die Differenz zwischen dem Kaufmann und dem Staatsbürger, zwischen dem Taglöhner und dem Staatsbürger, zwischen dem Grundbesitzer und dem Staatsbürger, zwischen dem lebendigen Individuum und dem Staatsbürger. Der Widerspruch, in dem sich der religiöse Mensch mit dem politischen Menschen befindet, ist derselbe Widerspruch, in welchem sich der bourgeois mit dem citoyen, in welchem sich Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft mit seiner politischen Löwenhaut befindet.“
Marx zitiert zustimmend eine Passage von Rousseau: „Wer sich daran wagt, ein Volk zu errichten, muss sich imstande fühlen, sozusagen die menschliche Natur zu ändern; jedes Individuum, das von sich aus ein vollendetes und für sich bestehendes Ganzes ist, in den Teil eines größeren Ganzen zu verwandeln, […]“. Diese grundlegende Änderung der menschlichen Natur beschreibt Marx als ‚Emanzipation‘: „Die politische Emanzipation ist die Reduktion des Menschen, einerseits auf das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische unabhängige Individuum, andrerseits auf den Staatsbürger, auf die moralische Person. Erst […] wenn der Mensch seine eigenen Kräfte als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht.“
Für Marx ist die Emanzipation offenbar ein Vorgang der gesellschaftlichen Transformation, eine Entwicklung, vergleichbar mit jener, welche er später als Kommunismus bezeichnen wird. Rousseau hingegen diskutiert, in der von Marx zitierten Passage, die Aufgabe des Gesetzgebers in der von ihm beschriebenen Demokratie. Wenn man versucht, diese Ausführungen auf das Problem des Nimbyismus anzuwenden, dann sind Rousseaus Überlegungen besser anwendbar. Politikerinnen und Politiker (damit sind hier auch Aktivistinnen und Aktivsten gemeint, und alle Menschen, die eine entsprechende Vision vertreten) stehen bei der Verkehrswende und Energiewende vor der Herausforderung, die Menschen davon zu überzeugen, im Gemeininteresse zu handeln. Im Fall der Energiewende muss dies sehr bald geschehen, wenn die Menschheit eine Chance haben soll, die drohende Klimakatastrophe zu vermeiden.
Eine Gesellschaft ohne Entfremdung wäre sicherlich ein erstrebenswertes Ziel, aber wir können mit der Energiewende nicht bis zum Kommunismus warten. Aber, selbst wenn diese Überlegungen auf die Energiewende und die Verkehrswende anwendbar sind, dann stellt Rousseau die Herausforderung noch zu groß dar: Politikerinnen und Politiker (im erweiterten Sinne) müssen für die Energiewende und die Verkehrswende nicht die Natur des Menschen ändern; es würde reichen, sie davon zu überzeugen, in ihrem eigenen langfristigen Interesse, und in dem Interesse ihrer Kinder, die zur Debatte stehenden Infrastrukturprojekte zu unterstützen.
Die verteilungspolitische Dimension des Nimbyismus
Während Marx‘ Entfremdungstheorie vergleichsweise schwer zugänglich ist, lassen sich Kenntnisse von Marx‘ Ausbeutungstheorie unter Linken fast voraussetzen. In der marxschen Theorie der Ausbeutung ist der Arbeiter im Kapitalismus zwar rechtlich frei, aber auch frei von „von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen“. Die Verhandlungspositionen beim Abschluss des Arbeitsvertrages sind sehr ungleich: der Arbeiter ist auf die Produktionsmittel angewiesen, die das Unternehmen besitzt, der Unternehmer kann daher die Bedingungen des Arbeitsvertrages diktieren, und sich den vom Arbeiter produzierten Mehrwert aneignen.
Ein Mietvertrag lässt sich, ähnlich wie der Arbeitsvertrag, als ein Ausbeutungsverhältnis analysieren. Menschen sind auf eine Wohnung angewiesen, viele Mieter haben aber keine reale Möglichkeit, sie selbst zu besitzen. Der Vermieter kann also – insbesondere in Ballungsräumen mit Wohnungsmangel – die Bedingungen des Mietvertrages diktieren, und mit hohen Mieten Profite erwirtschaften. Es ist klar, dass Die Linke aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit auf den Seiten der Mieterinnen und Mieter in den Großstädten ist.
Diese Mieterinnen und Mieter haben nur ein geringes Interesse daran, die Landschaft in den Vororten und im ländlichen Raum vor dem Bau von Schienentrassen, Windkraftanlagen, etc. zu schützen – denn so schön die Landschaft dort auch sein mag, man müsste erst einmal mindestens 20 Minuten aus der Stadt herausfahren, um sie genießen zu können. Wer hingegen sind die Menschen, die ein Interesse daran haben, die Schönheit der Landschaft zu bewahren? Wer sind die Menschen, die gegen den Ausbau von Schienennetz, Stromtrassen oder Windkraftanlagen demonstrieren? Die Landwirte, die ihre Ackerflächen dafür hergeben sollen? Dann ist es nur eine Frage der Höhe der Entschädigung, wenn nicht, wie im Fall von Windkraftanlagen, die Landwirte daran selbst Geld verdienen können.
Es sind die Eigenheimbesitzenden in diesen Ortschaften, die nicht auf die unverbaute Natur in der Nähe ihrer Häuser verzichten wollen. Aber diese Menschen sind bereits relativ bessergestellt, verglichen mit den Mieterinnen und Mietern. Das Bedürfnis nach Erholung ist natürlich legitim – aber der Bau von Windkraftanlagen oder Schienentrassen verringert den Erholungswert der Landschaft kaum, denn selbst dann werden in einiger Entfernung von den Großstädten noch, in dieser Hinsicht ungestörte, Wäldern, Wiesen und Feldern verbleiben. Wenn in Städten hingegen Möglichkeiten zur Naherholung fehlen, dann sollte man ganz bewusst versuchen, entsprechende Flächen als Stadtparks oder Wiesen zu entwickeln (die zugleich dem Überflutungsschutz dienen können).
Die Gesellschaft im Allgemeinen hat ein Interesse an gut ausgebauten Verkehrsnetzen – nur sind Autobahnen vom Flächenverbrauch her suboptimal gegenüber Schienentrassen; die Zeit, welche die LKWs im Stau verschwenden, zeigt sich auch in höheren Preisen im Supermarkt. Die Gesellschaft insgesamt, aber insbesondere Menschen mit geringem Einkommen, haben ein Interesse an niedrigen Preisen. Deswegen hat der Ausbau des Schienengüterverkehrs auch eine höhere Priorität als der Deutschlandtakt für den ICE. Wer ein geringeres Einkommen hat, und nicht in der Verlegenheit ist, für einen zeitlich befristeten Job Langstrecke zu pendeln (reales Beispiel!) wird die langsamen, aber dank Deutschlandticket preisgünstigen, Regionalbahnen gegenüber dem teuren ICE bevorzugen. Zur Nutzung des ICE waren auf die Schnelle keine guten Zahlen zu finden, aber die Zahlen für den Flugverkehr sind leicht zugänglich – 2019, vor der Pandemie, sind nur 21 Prozent der Menschen in Deutschland in den Urlaub geflogen (und beruflich fliegen nur ca. 5 Prozent der Menschen). Das Flugzeug ist also offenbar nur das Verkehrsmittel für das oberste Drittel der Bevölkerung. Aus verteilungspolitischer Sicht spricht daher nichts dagegen, alle Subventionen für Flughäfen und den Luftverkehr zu streichen, und eine CO2 – Steuer auf Flugbenzin aus fossilem Rohöl einzuführen, die so hoch ist, dass synthetisches Kerosin aus erneuerbaren Energien kosteneffektiver ist. Dadurch würde der ICE, dessen Vorteile für das Klima sich dann auch am Preis zeigen würden, deutlich attraktiver, ohne dass es dafür den Deutschlandtakt braucht.
Die Vision des Deutschlandtakt sollte dennoch weiterhin verfolgt werden (und sogar zu der Vision eines Europataktes im Rahmen einer United Railways of Europe weiterentwickelt werden). Das Schienennetz muss für den Güterverkehr massiv ausgebaut werden, und durch eigene Hochgeschwindigkeitstrassen lässt sich ein größerer Kapazitätsgewinn erzielen. Dabei lässt sich das Ziel eines Deutschlandtaktes (oder Europataktes) mit verfolgen, durch die Priorisierung des Schienengüterverkehrs ergeben sich im Detail jedoch unter bestimmten Umständen andere Planungen. Für die Planung der Trasse Hannover-Bielefeld stellt sich z.B. die Frage, ob man nicht zugleich die Option für ein trimodales Güterterminal (Schiene, Straße, Binnenschiff) am Mittellandkanal schaffen kann, wenn die Trasse soweit wie möglich im Norden geführt wird.
Wer in den Vororten einer Großstadt ein Eigenheim besitzt, ist im Übrigen nicht nur gegenüber den Mieterinnen und Mietern privilegiert, sondern auch gegenüber den zukünftigen Generationen, welche die Kosten der absehbaren Klimakatastrophe zu tragen haben werden. Natürlich sind die meisten Menschen keine absoluten Egoisten, und wollen zumindest für ihre Kinder ein besseres Leben. Zugleich sind viele Menschen aber auch in der Lage, die Gefahren des Klimawandels zu verdrängen, sonst hätte die Energiewende höhere gesellschaftliche Priorität. Sahra Wagenknecht wollte ja offenbar Stimmen damit gewinnen, indem sie diese Schwäche der Menschen, drohende Gefahren so lange zu verdrängen, bis die Katastrophe eintritt, gezielt ausnutzt, sonst würde sie nicht gefordert haben, das Heizungsgesetz wieder abzuschaffen. Unabhängig davon, dass solche Gesetze im Rahmen der Energiewende im Detail aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit anders gestaltet werden müssen, so ist doch klar, dass für eine vollständige Abkehr von fossilen Brennstoffen benötigen, damit die zukünftigen Generationen nicht die extrem hohen Kosten der Klimakatastrophe zu tragen haben werden. Als politische Strategie kann der Populismus gegen die Energiewende deswegen auch nicht erfolgreich sein; dies war bereits das Fazit meines früheren Essays. Wenn in wenigen Jahrzehnten die (hoffentlich durch eine Erfolgreiche Energiewende abschwächte) Klimakatastrophe eintritt, dann werden PolitikerInnen wie Wagenknecht ein Negativbeispiel in den Geschichtsbüchern sein.
Die Notwendigkeit der Energiewende heißt jedoch nicht, dass man jede Stromtrasse uneingeschränkt befürworten muss. Die technischen Details der Energiewende sind für mich, anders als bei der Verkehrswende, bislang teilweise unklar, und ich will nicht ausschließen, dass aufgrund Fortschritte bei der Batterietechnologie die Gleichstrom-Höchstspannungstrassen nicht erforderlich sind. Andererseits ist die Energiewende so wichtig, dass es falsch wäre, sie mit dem Hinweis auf die sogenannte "Technologieoffenheit" zu verzögern. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass das Multihub noch nach Redderse kommen soll, so würde ich es nicht kategorisch ablehnen: Ich würde allerdings erwarten, dass der Netzbetreiber die anspruchsvollen technischen Fragen zur Energiewende beantwortet, und darauf bestehen, dass wir in der Gemeinde Gehrden (zu der Redderse gehört), im Gegenzug auch die Mittel erhalten, um dort zumindest die fehlenden Fahrradwege und Überflutungsflächen schaffen zu können.