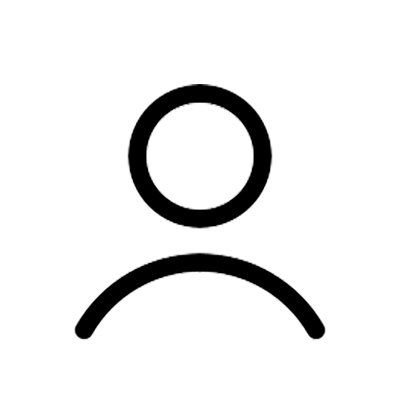Die Welt hat sich gedreht, Die Linke ist stehen geblieben
I. Einleitung
Für viele Mitglieder, die in den letzten Jahren der Linken beigetreten sind, dürfte der 16. Juli 2007 ein ganz normales Datum sein. Für die ehemaligen Mitglieder der WASG und der PDS hingegen bleibt dieser Tag wohl von besonderer Bedeutung. Mit dem Gründungsparteitag der Linken erfüllte sich ein Traum – oder, besser gesagt, ein Auftrag, der aus der Geschichte der Arbeiterbewegung stammt: die Einheit der Linken. Hätte man zur Jahrhundertwende vorhergesagt, dass es einmal eine vereinigte Linke links der Sozialdemokratie geben würde, hätte man wahrscheinlich – nicht ganz zu Unrecht – Lacher geerntet. Ausgerechnet Oskar Lafontaine rief den Delegierten auf dem Vereinigungsparteitag zu, dass man „vor der Geschichte versagt“ hätte, wenn die Vereinigung nicht zustande käme.
17 Jahre später steht Die Linke vor einem Scherbenhaufen. Die vereinigte Linke erwies sich als historisches Ausnahmeereignis. In West- und Ostdeutschland belegen die Wahlergebnisse ihre Bedeutungslosigkeit jenseits der großen Metropolen. Die Aufbruchstimmung von damals ist einer Mischung aus Ratlosigkeit und Katerstimmung gewichen.
II. Fehler der Vergangenheit
Die außergewöhnlichen Bedingungen, unter denen unsere Partei entstand, sind längst vorbei. Die Linke beziehungsweise ihre Vorgängerparteien spielten eine zentrale Rolle im außerparlamentarischen Protest gegen den Irakkrieg und die Agenda 2010. Diese Politik der rot-grünen Bundesregierung traf nicht nur marginalisierte Ostdeutsche, sondern gefährdete auch den Lebensstandard vieler Beschäftigter und Arbeitsloser in Westdeutschland. Sie erschütterte das sozialdemokratische Wählermilieu und führte zu einer tiefen Entfremdung der Gewerkschaften. Politisch gab es keine ernsthafte Opposition zur neoliberalen Agenda 2010 – alle großen Parteien zogen am gleichen Strang.
In diesem Kontext eröffnete sich nach Jahrzehnten die Möglichkeit, eine vereinte Linke neben der Sozialdemokratie zu gründen. Auf dem Erfurter Parteitag gab sich Die Linke ein Programm, das sich in die Tradition der Arbeiterbewegung stellte, die Gesellschaft als Klassengesellschaft analysierte und den Demokratischen Sozialismus als Ziel festlegte. In ihrer Praxis war Die Linke aber immer eine Partei des Anti-Neoliberalismus. Dieser Konsens, der verschiedenste linke Strömungen einte, verschaffte der Partei Handlungsfähigkeit und eine bedeutende Rolle im politischen Spektrum.
Doch dieser Gründungskonsens trägt heute nicht mehr, da der Neoliberalismus nicht mehr hegemonial ist. Auch die Mobilisierung gegen die Agenda 2010 verlor an Schwung und kam schließlich zum Erliegen. Alban Werner betont zu Recht, dass in dieser Phase die klassischen Themen sozialer Gerechtigkeit, wie Arbeitsbedingungen, durch andere Themen wie Atomkraft, ACTA und Stuttgart 21 verdrängt wurden. Die SPD gewann als Opposition zur schwarz-gelben Regierung wieder Vertrauen im gewerkschaftlichen Umfeld, während Parteien wie die Piraten und die AfD der Linken die Rolle der Protestpartei streitig machten.[1]
Spätestens hier hätte die Partei die veränderten Rahmenbedingungen erkennen müssen – doch das tat sie nicht. Sie stellte sich nicht der entscheidenden Frage, welche Rolle Die Linke in der Parteienlandschaft noch spielen kann, wenn a) der Anti-Neoliberalismus als Gründungsidee verblasst, b) das Image als Protestpartei abgelöst wurde und c) soziale Gerechtigkeit nicht mehr das zentrale Thema im gesellschaftlichen Diskurs ist.
Das Konzept der „verbindenden Klassenpolitik“ lieferte keine Lösung für diese Fragen. Statt sich mit den zentralen Richtungsfragen zu befassen, wurde es zum Modewort der Partei. „Es geht darum, unterschiedliche Kämpfe zu verbinden“, heißt es dazu aus der Bewegungslinken. „Während die Spaltung der Klasse im Kapitalismus Normalzustand ist, muss linke Politik Verbindungen schaffen, gemeinsame Interessen und Anknüpfungspunkte finden. Eine Hierarchisierung sozialer Kämpfe halten wir für falsch. Feministische Kämpfe, Lohnkämpfe, LGBTIQ*-Kämpfe, Proteste gegen die AfD, für Seenotrettung oder Klimagerechtigkeit können zusammengebracht werden.“[2]
Diese Aussage offenbart die Wurzel des Problems: das Konzept stützt sich auf den Intersektionalismus. „There is no hierarchy of oppression“[3], lautet ein zentraler Satz des Intersektionalismus. Menschen erfahren Diskriminierung nicht nur aufgrund eines Merkmals, sondern wegen einer Kombination aus Rassismus, Sexismus, Klassismus, Homophobie, etc.
Natürlich gibt es unterschiedliche Unterdrückungsformen in der Gesellschaft, und sie müssen anerkannt und analysiert werden. Auch die Partei muss sich mit diesen Feldern auseinandersetzen, um „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch erniedrigt, geknechtet, verlassen und verächtlich ist“. Intersektionalismus ist aber das falsche Werkzeug dafür. Er verwischt die qualitativen Unterschiede zwischen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen, indem er sie auf bloße Diskriminierung reduziert. Besonders beim Begriff des „Klassismus“ zeigt sich dies deutlich: Ökonomische Ausbeutungsverhältnisse werden hier zu einem Diskriminierungsproblem degradiert.
Da der intersektionalistische Ansatz keine Hierarchie der Unterdrückung zulässt, verhindert er jede Priorisierung von Themen. Das Argument „Wir dürfen die Kämpfe nicht gegeneinander ausspielen“ wurde zu einem Totschlagargument, das jegliche Schwerpunktsetzung unmöglich machte. Ein Beispiel ist der Antrag „Vielfalt verbinden: Wir kämpfen mit der ganzen Klasse“ an den Landesrat der Linken NRW[4], der die Partei verpflichten sollte, Fridays for Future, Ende Gelände, Queer-Initiativen, Black Lives Matter, die Volksinitiative "Gesunde Krankenhäuser in NRW", das Bündnis gegen das neue Versammlungsgesetz, Seebrücke, gewerkschaftliche Kämpfe und lokale Friedensinitiativen zu unterstützen.
Dieser Antrag zeigt das ganze Dilemma der verbindenden Klassenpolitik. Unterschiedlichste Gruppen mit oft widersprüchlichen Zielen wurden einfach nebeneinandergestellt, ohne die Konflikte zwischen diesen Zielen zu reflektieren oder produktiv zu bearbeiten. Ein eigenständiges Profil der Partei konnte so nicht entwickelt werden. Gewerkschaftliche und sozioökonomische Kämpfe wurden gleichrangig neben andere Themen gestellt. Für eine sozialistische Partei, die in der Tradition der Arbeiterbewegung steht, ist dies fatal.
Das problematischste und wahrscheinlich trügerischste an dieser Form der verbindenden Klassenpolitik ist, dass sie die Strategielosigkeit im Gewandt einer Strategie ist. Warum noch Strategiedebatten führen, wenn man angeblich schon eine Strategie hat? Und bloß keine Prioritäten setzen, sonst würde man ja die einen Kämpfe gegen die anderen ausspielen. So driftete die Partei ohne Linie und Orientierung von einer Krise in die nächste.
III. Aktuelle Diskussionen
Die aktuelle Diskussion in der Partei ist von Ratlosigkeit geprägt. Nach der Abspaltung war man sich eigentlich sicher, dass die Partei dann endlich durchstarten könnte. Nicht ohne Grund hatte man mit der „disruptiven Neugründung“[5] versucht, die Spaltung zu forcieren. Aufwendig inszenierte man auf dem folgenden Parteitag einen Aufbruch. Dieser Aufbruch entpuppte sich jedoch als Bruchlandung. Mittlerweile mehren sich die kritischen Stimmen, und eine vorsichtige Debatte über den Kurs der Partei hat begonnen. Es lassen sich eine Reihe von strategischen Ausrichtungen identifizieren, die derzeit zur Debatte stehen:
1. „Weiter so“
Nach den verheerenden Wahlniederlagen wagen nur wenige öffentlich, ein „Weiter so“ zu propagieren, dennoch läuft es in vielen Fällen darauf hinaus. Dahinter steckt die Fehlannahme, dass das schlechte Abschneiden der Partei primär als ein Kommunikationsproblem zu deuten ist. Vor der Abspaltung waren es die angeblichen „Wagenknechte“ und die „Sozialkonservativen“, die mit ihrer öffentlichen Kritik, das Ansehen und das Image der Partei schädigten und nach außen das Bild einer zerstrittenen Partei ohne Profil zu verantworten hatten. Nach der Abspaltung waren es dann die Spätfolgen dieser Ära, mit der die Partei zu kämpfen hat. Abgesehen von diesem Imageproblem war man sich jedoch einig, dass der bisherige Kurs der richtige ist. Folgerichtig musste man sich jetzt ums Image und die Profilschärfung kümmern und vielleicht die Methodik an der einen oder anderen Stelle anpassen.
Ausdruck dieses „Weiter so“ ist der Fahrplan 25 des Parteivorstands. Durch eine „Gesprächsoffensive in die Gesellschaft“ mittels Haustürbesuchen will man sich neu fokussieren und die politischen Schwerpunkte nach den Problemlagen der Menschen ausrichten. Dies gilt jedoch nur, wenn die Ergebnisse der Haustürgespräche in das eigene Weltbild passen. Was auf den ersten Blick basisdemokratisch und bürgernah erscheint, ist in Wirklichkeit eine Kapitulation des Parteivorstands vor seinen Aufgaben. Der Vorstand scheint nicht in der Lage zu sein, eigene Schwerpunkte und Fokussierungen festzulegen, und möchte sich stattdessen von den Wählern die Richtung vorgeben lassen. Die eigentliche Aufgabe einer Partei besteht jedoch in der Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse. Daraus muss sie ableiten, welche Rolle sie in der Gesellschaft einnimmt, wofür sie steht, wohin sie geht und welche Antworten sie auf die drängendsten Probleme hat. Erst dann kann der Dialog mit den Bürgern sinnvoll geführt werden. Es spricht nichts dagegen, die Erfahrungen aus diesen Gesprächen anschließend zu evaluieren und die entwickelten Positionen zu hinterfragen, nachzuschärfen oder zu verwerfen. Der Fahrplan 25 ist daher reine Methodenspielerei und das im schlechtesten Sinne, er läuft darauf hinaus das die Partei bis zu den Bundestagswahlen ihren bisherigen Kurs fortführt. Für eine echte Strategiedebatte bietet dieser Fahrplan keinen Raum.
2. Kopie von KPÖ und PTB
In der aktuellen Parteidebatte wird häufig auf die Erfolge der KPÖ in Österreich und der PTB in Belgien verwiesen, die gegen den westeuropäischen Trend gute Wahlergebnisse erzielen konnten. Daher fordern viele innerhalb der Partei, sich an diesen Parteien zu orientieren. Man verlangt eine klarere Profilbildung und Schwerpunktsetzung, ähnlich wie bei der KPÖ, kombiniert mit Sozialberatung und einem „Kümmerer“-Image. Zudem wird nach dem Vorbild der PTB eine Begrenzung der Mandatsträger und eine Arbeiterquote in den Parteigremien gefordert.
Diese Vorschläge sind durchaus diskussionswürdig. Eine klare Schwerpunktsetzung und der Aufbau von Sozialberatung, um Vertrauen außerhalb akademischer Milieus aufzubauen wären sicherlich Fortschritte. Doch eine Schwerpunktsetzung allein stellt noch keine Strategie dar, und die Orientierung an anderen Parteien ist oft trügerisch. So findet die Mieterberatung in Graz unter völlig anderen rechtlichen und politischen Bedingungen statt und kann daher nicht einfach übertragen werden. Zudem ist die Idee der „Kümmererpartei“ für Die Linke nicht neu. Insbesondere in Ostdeutschland war dies jahrzehntelang Praxis, deren Scheitern angesichts der konstant schlechter werdenden Wahlergebnisse jedoch in diesen Debatten nicht berücksichtigt wird.
Ebenfalls unklar ist, wie sich die Orientierung als „Kümmererpartei“ mit der Orientierung als „Bewegungspartei“ vereinbaren lässt. Denklogisch schließen sich diese Konzepte nicht aus, und in der Praxis kann man sicherlich beides verfolgen. Dann würde aber erneut das Profil darunter leiden. Eine produktive Auseinandersetzung über die Rollen und Aufgaben einer Partei und ihre Abgrenzung zu Bewegungen wäre notwendig, da hier unterschiedliche Parteimodelle aufeinandertreffen. Eine kritische Diskussion dieser Frage wäre sicherlich Teil einer umfassenden Strategiedebatte, die in diesem Kontext jedoch leider ausbleibt.
3. Fokus auf die „soziale Frage“
Teile der Partei fordern eine klare Fokussierung auf die “soziale Frage” und wollen die Welt der Arbeit in den Vordergrund rücken. Themen wie Rente, Mindestlohn und Umverteilung sollen die zentralen Themenfelder der Partei sein. So richtig diese Fokussierung auch sein mag, sie muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass dies bereits seit jeher gemacht wurde. Unter Bernd Riexinger und Katja Kipping wurde beispielsweise die Kampagne „Das muss drin sein“ entwickelt, die mit den Themen Wohnen und Pflege genau die geforderten Kernthemen zum Gegenstand hatte. Dies wirft die berechtigte Frage auf, warum ein Zurück zu den „Wurzeln“ der Partei ausreichend sein sollte, um sie aus der Krise zu führen.
Urike Eifler und Jan Richter weisen richtigerweise darauf hin, dass es nicht ausreicht, die „soziale Frage“ in den Vordergrund zu stellen. Entscheidend ist, wie man die „soziale Frage“ behandelt. Im Kern geht es darum, ob die soziale Frage rein moralisch und auf die Frage der „Gerechtigkeit“ reduziert wird oder ob sie als Teil von Klassenauseinandersetzungen im Rahmen widerstreitender Interessen thematisiert und adressiert wird. Der Vorschlag läuft darauf hinaus, die Klassenauseinandersetzungen nicht als eine von vielen Fragen zu behandeln, sondern als zentrale und strukturierende Frage voranzustellen.
Diese Einschätzung teile ich zwar, sie hat jedoch auch eine Kehrseite. Alexander Recht kritisiert in Bezug auf die Wirtschaftspolitik zu Recht, dass eine Linke im real existierenden Kapitalismus sich nicht auf die Stärkung der Arbeiterklasse beschränken darf. Sie muss auch Konzepte vorlegen, wie die allgemeinen Bedingungen der Kapitalakkumulation gewährleistet werden können, insbesondere in Zeiten, in denen diese Bedingungen durch die Einzelkapitalien nicht selbst durch hinreichende Profite gesichert werden können. Eine solche linke Wirtschaftspolitik wäre keine klassische Klassenpolitik im engeren Sinne und müsste folgerichtig abgelehnt oder nicht weiter thematisiert werden. Dies halte ich für falsch. Die Partei muss zwingend den blinden Fleck der Ökonomie überwinden und im Rahmen einer Reformstrategie auch Vorschläge für eine alternative Wirtschaftspolitik im Kapitalismus entwickeln.
Eine solche Wirtschaftspolitik muss jedoch nicht zwingend einer Klassenorientierung widersprechen. Sie könnte unter einen weiter gefassten Begriff der Klassenpolitik subsumiert werden, da solch eine Wirtschaftspolitik insbesondere die Durchsetzungsfähigkeit der Lohnabhängigen und ihrer Gewerkschaften verbessern würde. Ein solcher strategischer Ansatz darf jedoch nicht im luftleeren Raum konzipiert werden, er muss in eine Gesamtanalyse der gesellschaftlichen Verhältnisse eingebettet werden. (Dazu näher unter Punkt IV)
4. Fundamental/- und Systemopposition
Ein weiterer Vorschlag der aktuell diskutiert wird, aber im Kern schon seit Gründung der Partei immer wieder eingefordert wird ist, Die Linke als Fundamentalopposition und Protestpartei gegen das System. Diese Strategie sieht vor, Maximalforderungen zu erheben, Regierungsbeteiligungen konsequent abzulehnen, den Kapitalismus grundlegend zu kritisieren und sozialistische Lösung in den Vordergrund zu stellen. Eine solche Ausrichtung wäre in der Tat einzigartig im politischen Spektrum und würde der Partei ein inhaltliches Alleinstellungsmerkmal verschaffen.
Jedoch liegt genau hier das Problem: Es fehlt an einer gesellschaftlichen Basis, die für solche Forderungen empfänglich wäre. Wer ist der Adressat dieser antikapitalistischen Rhetorik ohne Durchsetzungsperspektive? Tatsächlich beobachten wir aktuell eine gegenläufige Tendenz. Der politische Diskurs hat sich nach rechts verschoben. Eine solche Ausrichtung würde völlig am Bewusstsein der Lohnabhängigen vorbeigehen und weiter in die Bedeutungslosigkeit führen. Auch die Idee, als Protestpartei wieder Anschluss an frühere Erfolge zu finden, führt in eine Sackgasse. Die Linke hat längst ihren Charakter als Protestpartei eingebüßt und wird ihn absehbar nicht zurückgewinnen. Für eine erfolgreiche Protestpartei bedarf es charismatischer Führungspersönlichkeiten, die in der Lage sind, den Protest zu bündeln und gegenüber dem „System“ zu artikulieren. Auf diesem Feld haben die AfD und insbesondere die BSW, angeführt von Sahra Wagenknecht, der Linken deutlich den Rang abgelaufen.
6. Zwischenergebnis
Es überrascht wenig, dass es in der Diskussion nicht den einen Ansatz geben wird, der die Partei aus ihrer Krise führen könnte. Deutlich wird jedoch, dass die bisherige innerparteiliche „Strategiedebatte“ auf Schwerpunkte und Methoden reduziert wird. Die Methodendebatte (Haustürwahlkampf, Organizing, Stadtteilarbeit, Sozialberatung etc.) ist keine zwingend politische Frage, sondern muss anhand der konkreten Ziele bewertet werden. Sie geht daher an der Fragestellung vorbei. Die Frage nach den Schwerpunkten ist hingegen zweifellos ein Teil der Strategiedebatte, bleibt jedoch oberflächlich, wenn sie nicht in eine umfassende Diskussion über gesellschaftliche Herausforderungen, Widersprüche und langfristige Entwicklungstendenzen eingebettet ist.
IV. Grüner Kapitalismus oder autoritäre Militarisierung[6]
Dabei ist es wichtig zu erkennen, dass sich nicht nur Die Linke an einem Scheideweg befindet, sondern auch die Gesellschaft. Wir haben es mit Vielfachkrisen zu tun, weil die ökologische Krise auf eine ökonomische, soziale und politische Krise trifft. Parallel dazu ist die Geopolitik im Umbruch. Wir leben in einer Zeit der Multipolarität und neuer machtpolitischer Konkurrenz, in der die Unipolarität zu Ende geht und gefährliche Konkurrenz und Machtkonstellationen hervorbringt.
In Antwort auf die ökologischen Herausforderungen versuchen die EU, die Bundesregierung und die Regierung Biden in den USA, eine ökologische Transformation hin zu einem grünen Kapitalismus voranzutreiben. Zu diesem Zweck greift der Staat durch Industriepolitik und Subventionen vergleichsweise intensiv in die Ökonomie ein.
1. Autoritäre Militarisierung
Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben sich die politischen Kräfte verschoben und es wurde auch in der EU eine Phase der Militarisierung eingeleitet. Diese ist mit einem grünen Kapitalismus nur bedingt vereinbar und muss als alternative Spur der Entwicklung oder als widerstreitendes Betriebssystem oder Akkumulationsregime begriffen werden. Die EU versucht beides gleichzeitig; und weil die Militarisierung geschichtlich immer mit technologischen Schüben einherging, könnte auch ein Nebeneinander den Weg markieren.
Allerdings sind die Ressourcen unter den gegenwärtigen Bedingungen begrenzt. Das gilt auch für die erheblichen finanziellen Ressourcen und Potentiale der EU als Währungssouverän, die durch die Bedingungen der EU-Verträge, der Schuldenbremse und der gegenwärtigen Besteuerung von Unternehmen und Vermögen beschränkt werden. Und es gilt für die natürlichen Ressourcen: Ein ökologischer Umbau muss auf die Einsparung von Ressourcen abzielen, während Rüstung und erst recht Krieg ungeheure Mengen unterschiedlicher natürlicher Ressourcen verschlingen. Arbeitskräfte, Produktionsmittel, Naturressourcen und Energie sind im Hinblick auf ihre Einsatzmöglichkeiten knapp.
Insofern muss die Politik Entscheidungen über die Priorität ihrer Verwendungen treffen. Es deutet sich auch schon an, dass die Militarisierung von Ökonomie und Gesellschaft in ein altes Freund-Feind-Denken zurückfällt und mit einer verstärkten politischen Repression nach innen verbunden sein wird. Eine rüstungspolitische Zeitenwende dürfte zu einem anderen Akkumulationsmodell und Regulationsregime führen, als eine sozial-ökologische Transformation. Spielräume für linke Politik und die Organisation einer solidarischen Gesellschaft gehen mit ersterem absehbar verloren. Zwischen diesen beiden Entwicklungswegen wird in den nächsten Jahren der politische Konflikt stattfinden.
2. Den Weg zum grünen Kapitalismus unterstützen
Für die Partei Die Linke kommt es darauf an, den Weg in Militarisierung, Sozialkürzung und ökologischen Stillstand zu verhindern und den Umbau zu einem sozial eingebetteten grünen Kapitalismus zu unterstützen, zu beschleunigen und idealerweise über ihn hinauszutreiben. Es gibt unter den gegenwärtigen Bedingungen keinen direkten Weg zu einer nachkapitalistischen Gesellschaft. Bis weit in die Grünen und die Sozialdemokratie hinein besteht heute Einigkeit, dass erhebliche Ressourcen durch den Staat mobilisiert werden müssen, um die Transformation erfolgreich zu bewerkstelligen.
Es ist unmöglich, dieses Projekt mit einem „Nachtwächter-Staat“ oder einem bloß ordnungspolitisch agierenden Staat durchzusetzen. Es bedarf vielmehr eines sozialen und ökologischen Interventionsstaates, der eine zentrale Rolle innerhalb des Transformationsprozesses und der wirtschaftlichen Entwicklung einnimmt. Ein solcher Staat hat die Aufgabe, über die Dekarbonisierung hinaus dringend erforderliche gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Die Linke muss auf die Erfüllung und Nutzung dieser „neuen“ Potentiale drängen: um die sozialen Folgen des Transformationsprozess durch einen starken Sozialstaat abzufedern und um die Breite der abhängig Beschäftigten für das Projekt zu gewinnen.
Die erforderlichen massiven Investitionen in die Wirtschaft, darunter vor allem die ökologische Erneuerung des Kapitalstocks können die Grundlage für ein neues „Jobwunder“ bilden. Um den ökonomischen Bedarf zu decken und zugleich Vollbeschäftigung zu erreichen, sind eine sozial ausgerichtete und inklusive aktive Arbeitsmarktpolitik sowie eine Ausweitung öffentlicher Beschäftigung erforderlich. Zudem setzt eine sozialökologische Transformation eine regulierte, qualifizierte Erwerbsmigration voraus.
Die Stärkung öffentlicher Beschäftigung und der Gewerkschaften muss zu stärker Tarifbindung, besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen führen. Klimaschutz wäre dann nicht automatisch mit Verzicht und Entbehrungen für die abhängig Beschäftigen verbunden, sondern stattdessen mit einer Verbesserung der Lebensverhältnisse. Der staatsinterventionistische Umbau zum grünen Kapitalismus bietet auch Ansatzpunkte, um weitergehende Perspektiven aufzuzeigen.
3. Spezifische Aufgaben der Partei Die Linke – Elemente der Hegemoniefähigkeit
a. Über den grünen Kapitalismus hinausgehen
Die Politik der Linken geht über den grünen Kapitalismus hinaus. Zum einen ist es Aufgabe der Linken, seine soziale Einbettung zu erkämpfen. Zum anderen halten wir an der langfristigen Perspektive einer nachkapitalistischen Gesellschaft fest. Diese lässt sich mit Marx so skizzieren: „Die Freiheit … kann nur darin bestehn, daß der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehn.“
Konkret bedeutet dies, dass Die Linke im Gegenzug für eine Zustimmung zu staatlichen Subventionen eine Demokratisierung der Wirtschaft einfordert, die Beteiligungen von Staat wie auch von Beschäftigten, Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und Natur- oder Verbraucherverbänden einschließt. Deswegen braucht es eine entschiedene linke Industriepolitik. Kurz: Der Green Deal muss zu einem Green New Deal werden. Hierfür zentral sind eine umfassende Umverteilungs- und Sozialpolitik, diverse Arbeitszeitverkürzungen sowie eine neue Politik der Gleichheit. Mit der Dekarbonisierungspolitik des Staates muss eine Politik sozialer Demokratie für soziale Sicherheit und Vollbeschäftigung verbunden werden.
Diese auf soziale Sicherheit angelegte Politik muss dem neuen technologischen Modell selbst eingeschrieben werden: Das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, Plattformbildung und andere Digitalisierungsprozesse greifen heute und seit 30 Jahren nicht nur in die Unternehmenswirklichkeit ein, sondern auch in den Arbeitsalltag von Beschäftigten und in die Lebenswelt der Menschen. Insgesamt verlaufen diese Prozesse bisweilen chaotisch und ungeordnet oder mit hohen, teils schmerzvollen Reibungsverlusten in verschiedenen Ebenen und Schichten der Gesellschaft.
Die Bundesregierung, aber auch die Opposition verfügen über keine Konzepte, wie diese Prozesse reguliert gestaltet werden können, so dass sie verständlicher, weniger verlustreich und mit Hoffnungen auf mehr Selbstentfaltung und Sicherheit verlaufen könnten. Die Aufgabe der Linken ist es, die Umwälzung der gesellschaftlichen Betriebsweise voranzutreiben und den lohnabhängig Beschäftigten und Sozialeinkommensbeziehern einen auskömmlichen Platz in der Gesellschaft zu sichern.
b. Hegemonieprojekt im Rahmen einer positiven Erzählung
Die ökologische Transformation darf kein Projekt des Verzichts und der Einschränkung sein, sondern muss einhergehen mit einem Umbau zu einem anderen besseren Leben mit weniger Arbeit und Stress, mit anderen Formen der Kommunikation und der Mobilität, in einer gesünderen Umwelt und gesünderer Ernährung, bei sozialer Sicherheit, mit einer Vielzahl von Möglichkeiten der Lebensgestaltung und der Persönlichkeitsentfaltung in gleichberechtigten Beziehungen. Es wird Gruppen und Kräfte geben, die eine ökologische Transformation unterstützen, davon einige, die sich Vorteile versprechen, und andere, die Nachteile in Kauf nehmen. Auch wird es in allen gesellschaftlichen Gruppen und Klassen Verlierer geben oder solche, die sich als Verlierer fühlen.
In Phasen der Transformation entwickelt sich eine „Furcht vor der Freiheit“ oder Furcht vor Neuem, was regressive Tendenzen fördert und sich gegenwärtig unter anderem im Zuspruch zur AfD zeigt. Die Ausgrenzung dieser Teile der Lohnabhängigen ist kein erfolgversprechender Weg. Um diese Teile einzubeziehen, muss die positive Erzählung bzw. das Hegemonieprojekt deren Sorgen aufnehmen, die vor allem in der Angst vor Kontrollverlust über das eigene Leben wurzeln. Zentrales Element des Hegemonieprojekts muss daher die Frage sozialer Sicherheit und die Stärkung des Staates in Bezug auf die Daseinsfürsorge sein.
Es gilt folglich, Kompromisse einzugehen und mit einer Mosaiklinken Bündnisse für einen positiven Reformismus zu organisieren. Ein solcher neuer Reformismus fördert Bündnisse mit progressiven Teilen der SPD und Grünen, mit Lohnabhängigen und Selbständigen, die auf SPD und Grüne orientieren, mit weiteren veränderungsbereiten Akteuren der Politik im demokratischen Spektrum sowie mit mitbestimmten Unternehmen. Diese Bündnispartner müssten veranlasst werden, einen Erneuerungspakt anzubieten. Die Linke fördert diese Bündnisse, um die Transformation zu beschleunigen.
In der politischen Auseinandersetzung geht es darum, Sichtweisen, Deutungen oder Interpretationen der Situation und Perspektive zu verbreiten oder zum unhinterfragten Konsens zu machen, kurz: Hegemonie zu erlangen. Politische Einstellungen werden im gesellschaftlichen Prozess geformt und ergeben sich nicht gleichsam naturnotwendig aus der Klassenlage. Den Neoliberalen ist es gelungen, aus der Verbindung von soziologischem Steuerungspessimismus der Systemtheorie, marktradikalen Vorstellungen, links-grüner Staatskritik und Kritik an tayloristischer Betriebsweise ein hegemoniefähiges Projekt zu entwickeln, das über Jahrzehnte die Denkgewohnheiten bestimmte.
Ein ähnliches Projekt kann für Die Linke die Erweiterung des Green Deal zum Green New Deal darstellen, indem erstens die Folgen des neoliberalen, marktradikalen Umbaus der Gesellschaft kritisiert und rückgängig gemacht werden (Beispiel: Miete und Rente), zweitens eine Militarisierung der Gesellschaft und die damit verbundene Umverteilung und repressive Schließung der Gesellschaft verhindert wird und drittens der ökologische Umbau der Ökonomie mit dem Ausbau staatlich-öffentlicher Steuerung verbunden wird. Gleichzeitig soll die Lebenswirklichkeit anders organisiert werden: soziale Sicherheit muss wiederhergestellt und neue Formen der Selbstbestimmung in Ökonomie und Gesellschaft eingefordert werden.
c. Strategische Konsequenzen für die Partei Die Linke und ihre Aufgaben
Die Partei muss anerkennen, dass das Konzept verbindender Klassenpolitik gescheitert ist. Es geht nicht um eine bloße Addition, sondern darum, verschiedene Fraktionen und Milieus der Lohnabhängigen entlang des Klassenwiderspruchs zusammenzuführen.
Das Problem besteht darin, dass sich aus der sozialen Lage nicht unmittelbar das Bewusstsein ableiten lässt. Das Bewusstsein wird vermittelt durch Konzepte der Lebensführung bzw. des Habitus. Das bedeutet, dass sich im Lauf der Generationen innerhalb von verschiedenen Gruppen der Lohnabhängigen verschiedene Arten der Lebensführung ausprägen, die die politische Orientierung weitgehend beeinflussen. Diese Konzepte der Lebensführung wandeln sich zwar, sind jedoch auch in zentralen Aspekten über Generationen hinweg stabil.
Wir können daher in der politischen Arbeit nicht von einem einheitlichen Klassenbewusstsein ausgehen, sondern müssen die Differenzen zwischen den verschiedenen Milieus überbrücken, um überhaupt politische Kämpfe führen und gewinnen zu können. Erst daraus ergibt sich längerfristig die Chance zur Erarbeitung von Klassenbewusstsein.
Die Überbrückung der Differenzen zwischen den zentralen Milieus der Lohnabhängigen bedeutet die Konzentration auf jene Politikfelder, in denen sich für sowohl konservative wie auch progressive Teil der Lohnabhängigen und die weniger Privilegierten Gemeinsamkeiten ergeben. Diese Brücke dürfte vor allem im Bereich der sozialen Sicherheit zu finden sein. Demzufolge müssen wir die sozio-ökonomischen politischen Themen in den Mittelpunkt stellen: Miete, Rente, Gesundheit sind unsere zentralen Politikfelder. Daneben ergibt sich die Notwendigkeit, für die gegenwärtig politisch zentralen Felder konsistente und realistische Konzepte zu entwickeln, um Fehler zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Fragen von Frieden und Migration.
V. Aussichten
Einen solchen Weg einzuschlagen ist in mehrerlei Hinsicht gefährlich für die Partei. Einerseits wird man zu Recht die Frage stellen dürfen, ob sich eine Linke hinreichend von SPD und Grüne abgrenzen kann, insbesondere wenn diese Parteien gegebenenfalls in der Opposition sind. Reicht es aus, dass Die Linke in den Auseinandersetzungen über die Transformation der Wirtschaft, über den Kapitalismus hinaus gehen möchte? – Bloße Lippenbekenntnisse ohne relevante Durchsetzungsbasis in den Betrieben und Gewerkschaften, werden jedenfalls nicht ausreichen.
Ein weiteres Problemfeld wird sein, ob es unserer Partei gelingt, mit dieser Strategie auch tatsächlich Unterstützung in breiten Teilen der abhängig Beschäftigten auch außerhalb der modernen und hochqualifizierten Milieus zu erreichen. Dies wird maßgeblich davon abhängen, welche Durchsetzungskraft der erforderliche soziale Interventionsstaat haben wird. Die Gefahr, dass Die Linke am Ende scheitert, ist groß, eine realistische Alternative zu dieser Strategie ist aber dennoch nicht in Sicht.
[1] Werner, DIE LINKE: Hoffen auf ein Licht am Ende des Tunnels, Sozialismus 1/2023 S.33.
[2] Ko-Kreis Bewegungslinke, „We like to move it move it“, Analyse & Kritik 655
[3] Audre Lorde 1999, In: Eric Brandt, Dangerous Liasons: Blacks, Gays and the struggle for Equality, New York, New York Press, S. 306.
[4] https://www.dielinke-nrw.de/fileadmin/lvnrw/Landesrat/Landesrat_03.07.2021/202107_Antrag_an_den_Landesrat_-_Vielfalt_verbinden.pdf
[5] Candaias, Mario, „Wir leben in keiner offenen Situation mehr“, in: Zeitschrift LuXemburg 2023, https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/wir-leben-in-keiner-offenen-situation-mehr/: Candaias plädierte in These 15 dafür, dass man die befürchtete Spaltung von Wagenknecht nicht mehr abwarten, sondern selbst forcieren soll, damit man nach der Abspaltung die Repräsentationslücke links von der SPD und den Grünen wieder füllen kann und bezeichnete diesen Prozess als „disruptive Neugründung“.
[6] Dieser Abschnitt stammt in gekürzter und leicht redaktionell veränderter Form aus dem Strategiepapier des LSR der Sozialistischen Linken NRW an dem Autor mitgearbeitet hat. https://nrw.sozialistische-linke.de/2024/09/18/zur-strategie-der-linken-wie-weiter/