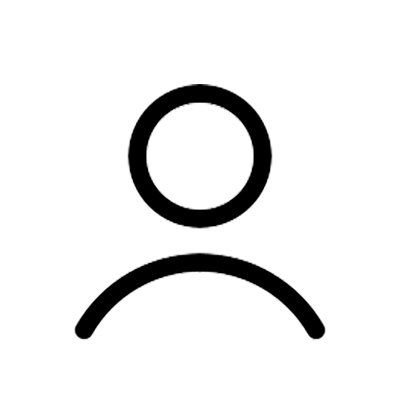Aber wie Klassenpolitik betreiben?
- Die Linke
- CC BY-NC-SA 2.0
Die strategische Debatte in der Linkspartei hat einen Schritt nach vorne gemacht. Während es nach den seit 2019 immer wiederkehrenden Wahlschlappen zumeist Analysen gab, die Differenzen betonten und deren Inhalt man eigentlich schon vor dem Lesen kannte, wird heute die Einigkeit betont und manchmal tatsächlich Neues aufgeschrieben. Gemeinsamkeiten gibt es bei der Krisenanalyse, die nicht besonders neu ist, aber jetzt in größerer Klarheit ausgesprochen wird.
Fast alle der für diesen Artikel untersuchten Texte zur Neuausrichtung der Partei stellen zurecht fest, dass die Zeit der Sammlungsbewegung gegen den Neoliberalismus, die 2009 noch erfolgreich war, zu Ende gekommen ist. Dieser Widerstand gegen die Implementierung der anti-sozialen Agenda2010, die Wirtschaftskrise, die Bankenrettung und gegen das durch die Schuldenbremse festgeschriebene Austeritätsregime habe Die Linke über alle Widersprüche der Vereinigung zwischen West und Ost, Parlamentarier*innen und Aktivist*innen, Gewerkschafter*innen und Bewegungslinken getragen.
Unterschiede gibt es bei der Frage, wie die vermeintlich goldene Zeit der Linken zu bewerten ist. Einige Kommentare betonen dabei, dass durch den Erfolg die Vereindeutigung linker Politik verschleppt und das Zusammenwachsen der unterschiedlichen Ansätze ignoriert worden sei. Das Netzwerk „Progressive Linke“ machte im März 2023 und noch einmal im Juni 2024 etwa den Fortbestand von „Formelkompromissen“ grundsätzlich für die Misere der Partei verantwortlich. Die Autor*innen kritisieren das „Hufeisen“ (Wagenknechts Bündnis mit Reformer*innen rund um Dietmar Bartsch) sowie jede Form populistischer Politik und fordern eine Ausrichtung auf konkrete Reformen im Sinne des „humanistischen Erbes“ der Linken. Dies soll durch einen „Bruch mit dem Leninismus“ und mit dem „raunenden Antikapitalismus“ ermöglicht werden.
Diese Argumentationslinie stützt sich auf die als erfolgreich wahrgenommenen Regierungsbeteiligungen in Berlin und Bremen und richtet sich gegen die – laut Eigenbeschreibung –radikalen und parlamentarismuskritischen Teile der Linken wie gegen diejenigen reformorientierten Kräfte, die sich eine stärkere Verankerung in der Bevölkerung und eine populistische beziehungsweise populäre Linke wünschen. Ähnlich argumentiert Jan Schlemermeyer, der im nd vor neuen „Jakobinern“ warnte.
Während die „Progressive Linke“ in ihren Forderungen trotz Schnittmengen zu Martin Schirdewan –der allerdings vor allem mehr Konkretisierung anmahnt und ansonsten das Verbindende sucht – relativ isoliert bleibt, gibt es bei den anderen Gruppen größere Überschneidungen. Hier wird die Zeit des Kampfes gegen den Neoliberalismus grundsätzlich positiv gesehen und es wird festgestellt, dass man bei Arbeiter*innen Stimmen verloren habe, die zurückzuholen seien. Dies soll durch eine sozialistische Klassenpolitik gelingen. Im Vordergrund der Parteiarbeit müsse das Aufwerfen und die Beantwortung der sozialen Frage stehen, also Umverteilung, gute Löhne, Existenzsicherung, Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, Kampf gegen Kürzungen. Damit solle die Vielstimmigkeit der Linken reduziert und ihre Glaubwürdigkeit erhöht werden. Man möchte eine strategische Fokussierung vornehmen, um in einer von spaltenden Kulturkämpfen geprägten Gesellschaft Gemeinsamkeit auf Basis von sozialen Interessen zu betonen. In diesem großen Konsens gibt es allerdings Unterschiede, die weiterhin das Potential zur Spaltung oder wenigstens zur Unklarheit haben, auch wenn diese erst einmal herausgearbeitet werden müssen.
Als Vertreter dieser Position zu nennen wäre hier etwa Michael Brie, der sich explizit gegen den „Progressivismus“ richtet, den er bei den akademischen Mittelschichten verortet. Wenn Die Linke erfolgreich sein wolle, dürfe sie nicht mit „offenen Grenzen“, der „Heraushebung der Genderdifferenzen in Sprache und Kultur“, radikal anmutender Klimapolitik oder der Kritik an der Leistungsideologie verbunden werden, sondern müsse anerkennen, dass gerade viele Arbeiter*innen Brot und Frieden wollten und gleichzeitig den Doppelcharakter des Fortschritts teilweise mit Abgrenzung beantworten würden. Natürlich fällt auch Bries Abrechnung mit dem bisherigen Kurs deshalb harsch aus. Man habe die Arbeiter*innen aktiv vergrault und die Strategie des „Progressivismus“ sei schuld an der Abspaltung des BSW. Mit Zahlen unterlegt das Carsten Braband in seinem Beitrag zum Verbleib der ehemaligen linken Wähler*innen. Diese Wähler*innen seien besonders gespalten gewesen, weshalb die Positionierung in Fragen der Migration oder des Klimas „Triggerpunkte“ gewesen seien, um diese von der Linken zu entfremden. Ulrike Eiflers Interpretation der Ergebnisse geht in eine ähnliche Richtung, was von ihr noch mit dem Hinweis auf Gewerkschaftspolitik konkretisiert wird. Man habe mit einer Ansprache der Mittelschicht und ihrer Themen eine andere Positionierung verunmöglicht, die verbindende Klassenpolitik habe gespalten.
Als Beispiel für zukünftige Konfliktfelder dieser Art nennt sie etwa das bedingungslose Grundeinkommen (BGE), welches die Leistung der Arbeiter*innen entwerte und deshalb von den Gewerkschaften abgelehnt werde. Alternativ zu dieser Strategie müsse man die „Wut der Klasse“ ansprechen. Auch Ines Schwerdtner kritisiert die fehlende Fokussierung auf die Klasse und beispielhaft die Aufstellung von Carola Rackete als Co-Spitzenkandidatin für das EU-Parlament. Die damit verbundene Strategie, Grünen- und SPD-Wähler*innen für sich zu gewinnen, sei gescheitert.
Bei den konkreten Forderungen dieses Lagers geht die Linksjugend mit, obwohl sie das Entweder-oder inhaltlich nicht teilt, sondern vor allem auf radikale sozialistische Forderungen setzt, die die Klassenauseinandersetzung deutlich machen sollen. Damit ist in diesem Fall keine Kritik an bewegungspolitischen Positionen verbunden. Ähnlich sehen es Thomas Goes und Mario Candeias, die eher auf der „bewegungslinken“ Seite verortet und in den Texten der anderen klassenpolitisch orientierten Autor*innen teilweise explizit kritisiert werden. Nichtsdestotrotz machen auch sie deutlich, dass ein sozialistischer Klassenansatz nach vorne zu stellen sei, um linke Inhalte wieder in der Bevölkerung zu verankern. Auch Janine Wissler, die noch deutlich stärker mit dem „Bewegungsansatz des Parteivorstandes“ identifiziert wird, hat sich in einem Beitrag dahingehend geäußert, dass „wir uns auf wenige Kernfelder konzentrieren“ sollten. Als Beispiele nennt sie dafür „Gute Arbeit, soziale Infrastruktur und gerechten Sozialstaat“.
Man könnte überrascht sein von so viel Einheit in der Linken. Auch wenn es zumindest zwischen dem Ansatz der „progressiven Linken“ und der „Klassenpolitiker*innen“ durchaus noch einen Widerspruch gibt, so könnte man auch hier sagen, dass das Bemühen um Konkretisierung, Parteiarbeit mit „Gebrauchswert“ (auch wenn der Begriff als Phrase abgelehnt werden sollte) und das Aufgreifen der sozialen Lage Konsens ist.
Die Widersprüche, die nicht nur zwischen den oben genannten Polen, sondern zwischen den jeweiligen klassenpolitischen Ansätzen aufkommen, sind aber gerade beim zweiten Blick darauf zu groß, um sie zu ignorieren. Obwohl (fast) alle die soziale Frage priorisieren wollen, gibt es keine Klarheit darüber, was die soziale Frage ist und wie deren Behandlung durch uns bei den Menschen ankommen soll. Steht dabei eine „aktive Industriepolitik“ im Vordergrund, für die wir Mehrheiten organisieren und die wir im Parlament durchsetzen wollen? Widerspricht das mehrheitlich per Mitgliederentscheid beschlossene BGE einer Neuausrichtung der Strategie, weil es die „Anerkennung von Leistung“ verhindert?
Wenn auch 73 Prozent der Arbeiter*innen (wen auch immer solche Studien damit genau meinen) die Sanktionierung von „Totalverweigerer*innen“ fordern, weil das Thema in den Medien rauf und runter läuft, vergessen wir dann unsere Position? Sollen Themen, wie etwa die Forderung nach offenen Grenzen, einfach nicht mehr moralisch begründet und nach vorne gestellt oder gleich ganz aufgegeben werden? Wogegen richtet sich die „Wut der Klasse“ eigentlich und sollte Die Linke jetzt eher gegen die Grünen polarisieren und weniger die AfD bekämpfen?
Ist eine Politik gegen Großkonzerne und für den lokalen Wirtschaftsstandort Ausdruck von Klassenorientierung und wenn ja, an welcher Klasse wird sich orientiert? Wie reagiert Die Linke, wenn sie in Kulturkämpfe rund ums Gendern oder Klima hineingezogen wird, wenn Leute wissen wollen, was ihre Position zu Geschlechtergerechtigkeit und Kohleausstieg ist? Gehört eigentlich Friedenspolitik zur Klassenpolitik, und wie könnte man etwa den oft bemühten „revolutionären Defätismus“ Lenins umsetzen, wenn diese Haltung auf so wenig Zuspruch stößt?
Weitere Widersprüche werden bei der Frage aufkommen, wie der Status Quo zu bewerten ist. Im Beitrag von Monika Hohmann und Eva von Angern aus Sachsen-Anhalt, die über eine erfolgreiche Spendenaktion berichten, wird sich auch positiv auf die KPÖ bezogen. Ebenso betonen Hohmann und von Angern aber, dass die gelobten Grundsätze immer diejenigen waren, die die PDS und Die Linke „getragen“ hätten und die auch jetzt schon gelebt würden. Damit geht es nicht um einen Kurswechsel, sondern um eine Fortführung der geschilderten Beispiele für „Best Practices“ und um eine „Rückbesinnung“.
Zwischen Plädoyers für ein partielles Weiter-So, der Konzentration auf alte Stärken oder der Weiterentwicklung der Parteiarbeit – etwa durch eine „neue politische Kultur“ – gibt es aber zumindest semantisch himmelweite Unterschiede, die derzeit nicht herausgearbeitet werden. Eine weitere wichtige Frage ist, wie die zahlreichen Pläne organisatorisch umgesetzt werden sollen. Bei den meisten Autor*innen stehen konkrete Berührungspunkte (etwa „Küchen für alle“), Sozialsprechstunden und die Bearbeitung des vorpolitischen Raums hoch im Kurs. Man orientiert sich am Vorbild der KPÖ, die den vom Kapitalismus gebeutelten Arbeiter*innen konkrete Hilfe anbietet, Menschen mit Freizeitangeboten gewinnt und damit auch als Vertreterin eines Teils der Arbeiterklasse wahrgenommen wird.
Aber die Kritik an der Berufspolitik gehört untrennbar ebenfalls zur KPÖ-Strategie. Auch wenn in vielen Linkspartei-Diskussionen die Forderungen nach Mandatsträgerabgaben für soziale Zwecke und Regelungen für die personelle Erneuerung sowie eine kritische Haltung zu Regierungsbeteiligungen vorkommen, so bleibt dies der entscheidende Punkt, der uns derzeit noch von einer erfolgreichen Adaption einer neuen Strategie trennt. Denn während die Klassenpolitik zumindest derzeit von allen gelobt wird, so ist die Umsetzung eines anderen Umgangs mit Mandaten deutlich schwieriger – man denke an die Grünen in den 1980er- und die PDS in den 1990er-Jahren.
Denn genau dieser Umgang ist ja der Ausgangspunkt des Problems, das organisationspolitisch stets beklagt wird: Das Fehlen eines strategischen Zentrums, weil der Parteivorstand gegenüber den Landesregierungen und den Fraktionen grundsätzlich in der schwächeren Rolle ist. Die Frage, welche viele der Autor*innen wahrscheinlich anders beantworten würden, ist also: Wie zentral ist ein neuer Umgang mit Mandaten für eine erfolgreiche Klassenpolitik und wie soll dieser Ansatz durchgesetzt werden?
Auf diese Probleme kann allerdings eine Antwort gefunden werden, wenn man einen Schritt zurück macht. Die Frage, was Klassenpolitik eigentlich ist, wurde bis jetzt nämlich nur gestreift. Deshalb machen die Plädoyers teilweise den Eindruck, es gehe schlicht um eine verschärfte sozialpolitische Auseinandersetzung. Tatsächlich ist aber Klassenpolitik, wenn der Begriff etwas bedeuten soll, etwas grundsätzlich anderes als bürgerliche Politik. Während auch ein CDU-Politiker wie Norbert Blüm gegen den Neoliberalismus austeilen konnte und sich für manche Flügel in der Linken immer wieder Bündnisse mit liberalen Bürgerrechtler*innen oder konservativen Außenpolitiker*innen fanden, beansprucht die Klassenpolitik qua definitionem, eine grundsätzlich andere Perspektive. Sie geht davon aus, dass die Arbeiterklasse ein Sonderinteresse hat, welches nicht in der Gesamtbevölkerung oder im Staat aufgeht. Klassenpolitik bedeutet, nicht für „das Volk“ Politik zu machen, sondern für die Arbeiter*innen, also die Klasse der lohnabhängig Beschäftigten. Denn das „Staatsvolk“ setzt die Vorstellung voraus, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, was es in einer Klassengesellschaft, in der die Lohnabhängigen den Kapitaleignern in einem fundamentalen Interessenkonflikt gegenüberstehen, aber nicht geben kann. Anders gesagt: „Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat“ (Marx/Engels: Das Kommunistische Manifest, 1848).
Das behauptete Gesamtinteresse ist aber notwendig kapitalistisch, denn der Staat ist nun einmal „eine wesentliche kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten, ideeller Gesamtkapitalist“ (Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, 1880). Die Überschneidung von Klasseninteressen, die beispielhaft bei der Wirtschaftsförderung behauptet wird, ist dabei trügerisch, denn das gute Abschneiden der deutschen Industrie beim Export hat nicht ohne Grund dazu geführt, dass die Lage der Arbeiter*innen in Griechenland schlechter wurde. Marx formuliert in diesem Sinne eine scharfe Kritik an der parlamentarischen Demokratie und an dem widersprüchlichen Verhältnis von Citoyen und Bourgeois, also an dem Staatsbürger, der für das Gesamte zuständig ist, und dem Bürger, der in der kapitalistischen Konkurrenz gegenüber anderen bestehen muss (Marx/Engels: Die deutsche Ideologie, 1845-46).
Gegen diese kapitalistische Herrschaftsform muss das Proletariat sich organisieren und die eigenen Interessen für sich vertreten, wobei Beteiligung am demokratischen Prozess und Klassenbündnisse nicht grundsätzlich ausgeschlossen sind. Letztlich ging es immer um mehr Demokratie, wenn damit mehr Freiheit und Selbstbestimmung zu erreichen ist – und Marx und Engels waren grundsätzlich für jede Ausweitung demokratischer Regierungsformen und in den 1840er-Jahren aktive Befürworter bürgerlicher Revolutionen, obwohl die „moderne Staatsgewalt [...] nur ein Ausschuss [ist], der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet“ (Marx/Engels: Das Kommunistische Manifest, 1848).
Grundsätzlich habe das Proletariat aber die Möglichkeit, als fortschrittlichste Klasse ein besseres Gesellschaftssystem zu errichten. Dabei war es auch schon im 19. Jahrhundert klar, dass es unter den Arbeiter*innen Einstellungen gab, die der Umsetzung ihrer fortschrittlichen objektiven Interessen entgegenstanden. Vielmehr wurden subjektive Interessen betont, wie etwa die Geltung der eigenen Nation, rassistische und antisemitische Vorurteile oder die gewünschte Privilegierung gegenüber vermeintlich anderen Gruppen. Deshalb musste sich die Zweite Internationale, die in vielen Fragen von Engels beraten wurde, auch mit dem Zurückdrängen antisemitischer und chauvinistischer Positionen, wie sie etwa von Henry Hyndman artikuliert wurden, beschäftigen.
Damals wie heute scheint es nicht besonders effektiv, einfach an die objektiven Interessen der Lohnabhängigen (also die Aufhebung der Klassengesellschaft – und bis dahin mehr Freiheit und mehr Einkommen) zu appellieren. Es braucht eine aktive Auseinandersetzung mit dieser Problematik. Das heißt natürlich nicht, dass man den Kampf gegen den Kapitalismus, die konkrete Hilfe im Alltag und das Agitieren für radikale Sozialreformen nicht trotzdem nach vorne stellen sollte. Aber obwohl Rosa Luxemburg ihre Arbeit zwar auf die Frage nach „Revolution und Sozialreform“ fokussiert hat, so hätte sie doch niemals zu ihrer Haltung zum Nationalismus, nationaler Unterdrückung und zu anderen Themen geschwiegen. Andere Marxist*innen stritten ausdauernd über Geschlechterrollen, Migration, die Funktion von Kirche und Religion und den Kolonialismus. Ihr relativer Erfolg lag also weniger daran, dass sie sich thematisch beschränkt hätten, sondern an ihrem Selbstverständnis als Vertreter*innen ihrer Klasse. Daraus lassen sich drei Thesen für die anstehenden Widersprüche ableiten, die aus meiner Perspektive eine deutlich stärkere Berücksichtigung in der Strategiedebatte der Linken finden müssen.
Erstens müssen wir das Ziel unserer Politik neu definieren. Damit ist nicht gemeint, alles jenseits der Revolution links liegen zu lassen. Vielmehr ist damit gemeint, dass wir die Klassenperspektive dann schon aufgeben, wenn wir beständig auch in der Opposition und auf der Straße die Regierungsperspektive einnehmen, also immer neue Aktions- und Arbeitsprogramme entwickeln oder außenpolitische Forderungskataloge vorlegen, die nicht nur der deutschen Regierung ihre Arbeit erklären, sondern auch den Vereinten Nationen und kriegsführenden Regierungschefs, die im Zweifelsfall noch nie von der Linken gehört haben. Wir haben noch nicht einmal im Ansatz entwickelt, wie eine proletarische Außenpolitik aussehen könnte, sondern verharren in einem Willy-Brandt-Reenactment, welches die „legitimen Interessen“ aller „Gesamtkapitalisten“ berücksichtigen soll.
Abgesehen davon, dass Staaten im Krieg die Interessen der Gegenseite explizit nicht berücksichtigen wollen, sagen wir damit immer dasselbe wie die liberalen Parteien, nur, dass wir ihnen Inkompetenz bei der Erreichung ihres angeblichen Friedensziels vorwerfen. Natürlich muss man sich trotzdem zu Kriegen, Gewaltakten und staatlichen Morden verhalten sowie gegen die Militarisierung einstehen, die hier vor Ort stattfindet, aber unsere Friedensprogramme passen derzeit eher zum Denken utopischer Frühsozialist*innen. Es ist klar, dass wir damit versuchen, an das Alltagsbewusstsein anzudocken, aber es stärkt weder den Glauben an die Umsetzbarkeit unserer Ideen, noch stellt es ein Alleinstellungsmerkmal für die Partei dar, wenn in der Zeitung neben den obskuren Forderungen der CDU noch steht, was Die Linke der Ampel jetzt wieder vorschlägt.
Zweitens dürfen wir auf radikale Kritik an der Berufspolitik und am parlamentarischen Alltag nicht verzichten. Wir brauchen einen anderen Umgang mit Mandaten, also Zeitbegrenzungen und Beschränkung der Diäten auf ein Facharbeitergehalt, sowie eine Politik, in der der Parlamentarismus nur ein Teil der Strategie und dabei eher das ausführende Ende als der Kopf des Ganzen ist. Diese Umstellung wird schwierig, weil der Status Quo zusätzlich mit sehr konkreten Interessen verbunden ist und der politischen Praxis in der bürgerlichen Demokratie eher entspricht. Deshalb muss diese Kritik in den Vordergrund der Strategiedebatte, auf eine vernünftige Art und Weise, die keinen Streit provoziert, ihm aber auch nicht aus dem Weg geht. Der enorm große Konsens in dieser Frage, der aus den Texten hervorgeht (von der Progressiven Linken bis zu Michael Brie widerspricht niemand), muss Grundlage dafür sein, hier schnell und bundesweit etwas zu ändern.
Drittens wird es nichts bringen, fortschrittliche und bei uns mehrheitlich beschlossene Positionen zu verschweigen oder zu verleugnen. Sie müssen in Bezug zur Klassenfrage gesetzt werden, also es muss zu begründen sein, wieso wir mit einer Forderung den Glauben verbinden, die sozialen Interessen der Arbeiter*innen zu stärken. Die Linke hat sich dazu entschlossen, offene Grenzen als Voraussetzung für Humanismus zu sehen. Sie hat sich dazu entschlossen, die Klimakatastrophe ernst zu nehmen. Und sie hat sich dazu entschlossen, die Überwindung des Patriarchats für eine zentrale Aufgabe zu halten. Diese Beschlüsse wird kein Bundesparteitag aus strategischen Erwägungen rückgängig machen, schon aus politischen und technischen Gründen. Denn letztlich sind dies die inhaltlichen Positionen derjenigen, die die Partei als Mitglieder prägen. Und dass die Partei dem Willen der Mitglieder entspricht, ist ein Prinzip, das nicht ignoriert werden darf. Sozialistische Demokratie ist „kein fertiges Weihnachtsgeschenk für das brave Volk“ (Rosa Luxemburg: „Zur Diktatur des Proletariats“, 1918), sondern muss mit Leben gefüllt werden. Das muss ebenso für eine sozialistische Partei gelten.
Das heißt nicht, dass man mit Arbeiter*innen, die derzeit andere Ansichten haben, nicht reden sollte oder dass man nicht trotzdem gemeinsam gegen Kürzungen, Lohnminderung und Ausbeutung kämpfen sollte. Eine solche Haltung widerspricht definitiv nicht einer notwendigen Radikalisierung der klassenpolitischen Kernforderungen. Aber sie bedeutet, dass wir immer damit rechnen müssen, dass diese Positionen eine Rolle spielen werden, einfach auch, weil andere Akteure sie durch spaltende Kulturkämpfe in den Vordergrund stellen. Es gibt in diesem Sinne keine Abkürzung zum Sozialismus. Genau wie die Sozialist*innen im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts nicht gut damit gefahren sind, den Vorwurf der „Vaterlandslosigkeit“ widerlegen zu wollen, werden wir nicht gut damit fahren, dem Vorwurf der „Abgehobenheit“ durch Verleugnung inhaltlicher Positionen zu begegnen.
Insgesamt lässt sich sagen: Wir haben schlicht keine andere Option, als uns als Klassenpolitiker*innen konkret zu beweisen und deutlich zu machen, dass wir eben nicht nur erzählen, dass wir anders sind, sondern unsere Arbeit auch anders machen. Das fängt mit unserer eigenen Organisation, unserem Verhältnis zu Anderen und dem Bezugspunkt unserer politischen Tätigkeit an und muss in konkreter Politik münden, die nicht nur auf das Fordern und Vorschlagen beschränkt werden darf, weil wir qua Eigendefinition als Sozialist*innen bereits deutlich gemacht haben, dass wir von einer bürgerlichen Regierung kaum etwas erwarten. Dafür braucht es radikale Kritik an der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsform, aus der sich andere Positionen ableiten lassen, kombiniert mit einer klassenpolitischen Organisationsform und konkreter Hilfeleistung im Alltag. Wie dies umsetzbar ist, darüber gibt es trotz der relativen Harmonie in den Analysen große Unterschiede, die geklärt werden müssen – das wird nicht überall gelingen, aber bei einigen wichtigen Fragen. Wenn wir Klassenpolitik machen wollen (was zu hoffen und zu begrüßen wäre), dann sollten wir uns darauf konzentrieren, wie wir diesen Ansatz auch konsequent durchhalten können.