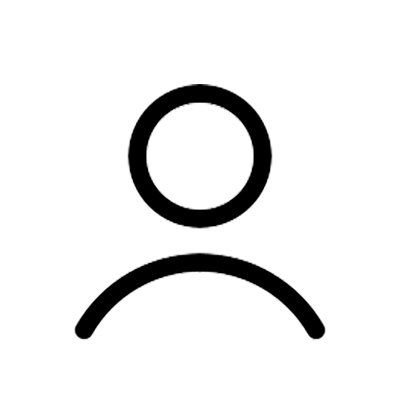Wie wir gewinnen können
Für eine Neuaufstellung der LINKEN als sozial-ökologische Zukunftspartei
Kurzfassung
1. Wir können wieder gewinnen. Aber dazu müssen wir die richtigen Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden der LINKEN bei den Bundestagswahlen 2021 ziehen. Zentral ist, dass wir rasch eine strategische und programmatische Klärung einleiten. Auf dem nächsten Parteitag sollten wir Richtungsbeschlüsse in der Außen- und Europapolitik und im Hinblick auf den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft fällen, die eine Neuorientierung bindend für Partei, Fraktion und die jeweils leitenden Führungsgremien untersetzen.
2. Die LINKE hat nur als Motor eines grenzübergreifenden sozial-ökologischen Politikwechsels eine Chance – als ‚sozialrebellischer’ Arm eines Green New Deals. Wir können gewinnen, wenn wir die System- und Verteilungsfrage stellen und sie mit einer radikalen Reformpolitik beantworten, die Menschen in Stadt und Land, Ost und West, alt und jung, quer zu Berufsgruppen und Bildungsabschluss im Kampf für eine gerechte Zukunft zusammenbringt.
3. Die LINKE hat nur dann eine Chance, wenn sie auch in der öffentlichen Wahrnehmung wieder ein solidarisches Verhältnis zu Initiativen und Bewegungen einnimmt, die in der Gesellschaft fortschrittliche Anliegen vertreten – seien es Gewerkschaften, Streiks für Klimagerechtigkeit oder die jüngeren Kämpfe des Feminismus und des Antirassismus.
4. Als Leitbild für die Zukunft schlagen wir ein 3-Säulen Modell vor, das die Kernkompetenzen der bisherigen Partei-Strömungen verbindet. Das heißt: a) Organizing, verstärkte gesellschaftliche Verankerung und ein aktives Parteiverständnis, b) Klarheit der öffentlichen Kommunikation und Gegnerorientierung im Sinne eines linken Populismus, sowie c) fortschrittliche Programmatik und klarer Gestaltungswillen.
Lehren aus der Bundestagswahl 2021
Wir können wieder gewinnen. Doch dazu müssen wir die richtigen Lehren aus der Niederlage bei den Bundestagswahlen 2021 ziehen. Sie ist nicht einfach die Folge von handwerklichen Fehlern. Die Wahl zeigt nicht Unklarheiten über unsere inhaltlichen Positionen, sondern über unseren politischen Gebrauchswert und unsere Wirkung. Unsere Krise hängt vor allem damit zusammen, dass wir es als Partei insgesamt nicht geschafft haben, angemessen auf grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft zu reagieren. Die Opposition gegen neoliberale Politik ist weiterhin wichtig. Aber wir müssen feststellen, dass sich unsere Gründungsfunktion als Sammlungsbewegung gegen den Neoliberalismus aus verschiedenen Gründen (Korrekturen bei SPD und Grünen, offene Krise des Neoliberalismus) erschöpft hat. Zudem wurde nach dem Ende der Ära Merkel, also ohne den „Schleier der Alternativlosigkeit“, die Frage nach der Funktion der LINKEN in einer veränderten Weltordnung scharf gestellt. Der äußerst engagierte Wahlkampf vieler Mitglieder und die über 2000 Neueintritte seit dem Wahlsonntag zeigen zugleich: Wir sind ein zentraler Anlaufpunkt für die Hoffnung auf eine gerechtere Gesellschaft und haben gute Voraussetzungen für ein Comeback. Aber die nächsten vier Jahre sind unsere letzte Chance dazu.
Für unser Abschneiden gibt es Gründe
1. Geschadet hat uns die falsche Unterstellung aus den eigenen Reihen, wir hätten Arme, Angestellte sowie Arbeiterinnen und Arbeiter aufgegeben. Schlecht war zudem die widersprüchliche Kommunikation bei Zukunftsthemen wie Migration, Klimaschutz sowie zur Unteilbarkeit der Menschenrechte. Das beste Wahlprogramm hilft nichts, wenn prominente Mitglieder sich nicht daran halten – und teilweise entgegengesetzte Positionen vertreten sowie die Partei hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenz systematisch schlecht reden. Die Wahlergebnisse zeigen, dass es nicht funktioniert auf eine Spaltung unserer Wählergruppen zu setzen, und die Bekanntheitswerte einzelner Politiker*innen das (siehe NRW) auch nicht ausgleichen können. Stattdessen demotivieren sie relevante Teile der eigenen Basis, gefährden unsere gesellschaftliche Verankerung und führen zu Verlusten in allen Richtungen.
2. Beim Thema Regierungsbeteiligung gibt es Parallelwelten in der Wahrnehmung. Einzelne Akteure in der Partei meinen, wir hätten einen reinen Regierungswahlkampf geführt. Aus ihrer Sicht stellt sich das wirklich so dar. In der breiten Öffentlichkeit war hingegen unklar, ob wir ernsthaft Regierungsverantwortung übernehmen wollen oder ob uns im Zweifelsfall nicht der NATO-Austritt wichtiger ist als der soziale Fortschritt. Zur Paradoxie dieses Wahlergebnisses gehört zwar, dass das zu Beginn des Wahlkampfes stark gemachte Ziel „CDU raus aus der Regierung, Laschet verhindern“ erreicht wurde. Dies gelang jedoch nicht zu Gunsten einer sozial-ökologischen Mehrheit. Dennoch gibt keine belastbaren Belege für die Behauptung, unsere Wählerschaft wäre wegen „programmatischer Zugeständnisse“ verunsichert gewesen. Alle Kleinstparteien, die für Fundamentalopposition stehen, haben nur sehr geringe Ergebnisse erreicht. Es gab keine Wählerwanderung nach links außen. Plausibler scheint daher: Ein Regierungswahlkampf funktioniert für die LINKE auf Bundesebene nur, wenn er auch programmatisch fundiert ist und von Vertrauen in unsere Politikfähigkeit getragen wird. Dies gilt vor allem, wenn Grüne und SPD eine Strategie der formalen Öffnung nach links bei realer Abgrenzung verfolgen. Eine Regierungsbeteiligung nicht auszuschließen ist noch kein Regierungswahlkampf. Ein Politikwechsel braucht solide Vorbereitungen, damit er glaubwürdig ist - und uns nützt.
3. Der Wahlkampf 2021 war nicht nur der erste ohne Titelverteidiger*in im Kanzleramt. Es war auch der erste Wahlkampf, in dem die SPD eine Koalition mit uns explizit nicht ausschloss. Das führte zu einem umgekehrten Glaubwürdigkeitsproblem. Erstens: Der SPD wurde nun nicht mehr per se abgestritten, es mit ihren sozialen Forderungen ernst zu meinen. In allen bisherigen Wahlkämpfen konnten wir sagen: Wer eine Koalition mit Union und FDP nicht, aber mit uns sehr wohl ausschließt, kann nicht ernsthaft für soziale Reformen eintreten. Das war diesmal nicht möglich. Zweitens: SPD und Grüne haben uns das erste Mal „als eine Partei wie alle anderen“ behandelt, d.h. sie haben sich nicht mehr grundsätzlich von uns abgegrenzt, sondern auf eine geschicktere Strategie der selektiven Konfrontation gesetzt. Dabei nahmen sie sich unfreundlicherweise nicht die sozialen Themen (mit denen wir sie treiben können) vor, sondern unsere aus diversen Umfragen bekannten Schwachpunkte - und lenkten die Aufmerksamkeit vor allem auf bestimmte außenpolitischen Positionen. Durch die Thematisierung unserer Achillesferse „missverständliche Formulierung zur Nato“ gelang es ihnen, in unserem Wähler*innenpotential Zweifel zu streuen, ob wir überhaupt willens sind, unsere sozialen Ziele umzusetzen. Vor dieser Strategie der selektiven Konfrontation (Übernahme sozialer Themen bzw entsprechender Überschriften bei harter Abgrenzung entlang bestimmter außenpolitischer Themen) wurde zwar im Vorfeld gewarnt. Die Partei in Gänze war aber noch nicht bereit, darauf angemessen zu reagieren.
4. Das öffentliche Auftreten unserer Bundestagsfraktion beim Afghanistan-Evakuierungsmandat hat Grünen und SPDler*innen den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Es hat den Eindruck bestärkt, dass uns im Zweifelsfall Dogmen wichtiger sind als Menschenleben. Ein Vorwurf, der ein echtes Problem ist – gerade in einem Wahlkampf, in dem sich alles um die Frage dreht, wie es „nach Merkel“ weiter geht. Die widersprüchlichen Signale verweisen auf programmatische Sollbruchstellen in der internationalen Politik, bei denen uns der politische Gegner genüsslich stellen kann. Hier fällt uns auf die Füße, dass wir eine programmatische Modernisierung zur EU und eine Verständigung über internationale Institutionen bisher versäumt haben. Fraglos war die Empörung der anderen Parteien über das Verhalten der Linksfraktion ein Manöver, um von ihrer Verantwortung für den 20jährigen Kriegseinsatz abzulenken. Doch mit Manövern der anderen Parteien muss man in einem Wahlkampfendspurt rechnen. Professioneller Wahlkampf bedeutet hier auch sicherzustellen, dass man der Konkurrenz nicht solche Munition liefert. Dazu kommt: Die NATO abzuschaffen, ohne andere internationale Organisationen (bspw. die EU oder die UN) stärken zu wollen, ist unrealistisch und wird in der Öffentlichkeit offenbar nicht als Antimilitarismus, sondern als Isolationismus wahrgenommen. So konnten wir angesichts massiver internationaler Krisen kein Vertrauen in unsere Politikfähigkeit schaffen.
5. Eine weitere Ursache liegt in Strukturproblemen unserer Partei im Osten wie im Westen. Wir haben im Osten in den vergangenen Jahren an Verankerung verloren und zugleich zu wenig neue Mitglieder gewinnen können. Ein oberflächliches Deutungsmuster dafür lautet, die PDS hätte im Osten einst ein Kernklientel von ‚Arbeitern’ und ‚einfachen Leuten’ gehabt, zu dem sie nun die Bindung verloren hätte. Dieser Deutung widersprechen wir. Die PDS war sozialstrukturell immer vielschichtig. Wähler- und Mitgliedschaft speisten sich schwerpunktmäßig aus gut und oft akademisch gebildeten ehemaligen Aktiven der DDR. Hinzu kamen diejenigen, die – quer zur Frage des beruflichen Status’ – Verlusterfahrungen in der Wendezeit gemacht haben sowie aus vielen jungen Menschen, die sich seit den 1990er Jahren gegen rechts einsetzten. Die Agenda-Politik von Schröder bewegte schließlich in der Zeit von 2004 bis 2007 viele dazu, eine eigene politische Formation zu gründen (WASG), um stärker in das Feld der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmerschaft (übrigens unabhängig von ihrem Bildungsstand) vorzudringen. Diese Konstellation, die die PDS und dann die LINKE getragen hat, ist zwischenzeitlich beendet. So wichtig es ist Gutes zu bewahren: nochmal einfach die „PDS“ oder die „WASG“ zu gründen, wird nicht weiterführen, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Retropolitik ist angesichts einer sich grundlegenden verändernden Gesellschaft (und Wählerschaft) keine Rettung.
Das gilt insgesamt. Das Wahlergebnis bietet für keine Strömung unserer Partei einen überzeugenden Anlass, um nun einfach (wieder) die jeweilige Perspektive zum Masterplan für das Ganze der Partei zu (v)erklären. Die Lösung ist nicht einfach „Bewegungspartei oder Gestaltungslinke“, „Linkspopulismus oder verbindende Klassenpolitik“. Diese Art von Tunnelblick ist vielmehr Teil des Problems und blendet das Wechselverhältnis zwischen öffentlicher Debatte, Kompetenzzuschreibungen, Image, Parteiaufbau, Motivation zur Wahl und zum Engagement aus. Die Lösung liegt in einer gezielten Kombination. Denn die verschiedenen Strömungen haben in ihrer Strategie alle richtige Aspekte, die in eine erneuerte gemeinsame Strategie einfließen müssen. Konkret lautet die übergreifende Frage: Wofür braucht es heute eine demokratisch-sozialistische Partei?
Die Zukunft
Unsere Antwort auf die Frage nach dem Gebrauchswert einer demokratisch-sozialistischen Partei heute kann nicht aus abstrakten Idealen kommen. Sie muss aus den aktuellen Herausforderungen entwickelt werden. Das ist in unserer Zeit vor allem die Auseinandersetzung um den sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Die verschiedenen Vorschläge für einen Green New Deal aus dem Umfeld der Partei liefern Impulse für solch ein übergeordnetes Projekt der im hier und heute beginnenden und zugleich über den neoliberalen Kapitalismus hinausweisenden Veränderung. Zugleich sind Diskussionen um die nötige Transformation auch in Wissenschaft und Gesellschaft in vollem Gange: Wie können Wirtschafts- und Investitionspolitik neu ausgerichtet werden (Adam Tooze)? Wie sind soziale und ökologische Systeme zukunftsfähig umzubauen (Maja Göpel)? Wie können die Traditionen der Gewerkschafts- und Arbeiter*innenbewegung eine produktive Rolle in diesem Veränderungsprozess einnehmen (Klaus Dörre/Hans Jürgen-Urban)?
Angesichts der multiplen Krisen der neoliberalen Weltordnung gilt es, grenzübergreifend einen sozial-ökologischen Politikwechsel durchzusetzen, um Klimakatastrophe, soziale Spaltung und Demokratiezerfall zu verhindern. Natürlich wäre das Ergebnis selbst im Erfolgsfall noch keine sozialistische Gesellschaft der Freien und Gleichen, allerdings immerhin schon mal: kein Weltuntergang. Es gäbe Schlimmeres. Es ist leider so: Die Rettung der Welt vor dem Kapitalismus ohnehin, die Rettung der Welt im Kapitalismus aber auch –man muss leider immer alles selber machen. Unser Ansatzpunkt ist: Die Zukunft für alle gewinnen, indem wir sie heute überhaupt erst mal retten. Das wäre die Aufgabenbeschreibung einer sozialistischen Funktionspartei im besten Sinne.
Um die anstehenden Veränderungen durchzusetzen, braucht es eine konfliktbereite Kraft, die die Eigentumsfrage nicht scheut. Der Koalitionsvertrag der Ampel zeigt nochmal deutlich: Ein Green New Deal als Zukunftspakt benötigt einen „sozialrebellischen Arm“. Schon um auf allen Ebenen für die sozial-ökologische Gerechtigkeit zu streiten, die Sozialdemokraten und Grüne nur versprechen, aber ohne den Druck von links nicht liefern werden. Der Markt regelt es nicht, deshalb müssen wir den Markt regeln. Für diese historische Aufgabe bringt die Partei – trotz allem – schon eine ganze Menge mit. Wir brauchen allerdings eine neue Kombination der jeweiligen (Strömungs-)Stärken. Schematisch lässt sich das auf folgendes Drei-Säulen-Modell herunter brechen: Organizing in Parteientwicklung, Verankerung und aktives Parteiverständnis (Bewegungslinke), Klarheit der öffentlichen Kommunikation und linkspopulistische Gegnerorientierung (Sozialistische Linke) sowie progressiv in Programmatik und Gestaltungswillen (FDS).
Neben Organisationsentwicklung und kommunikativer Geschlossenheit geht es also auch um eine programmatische Modernisierung. Dabei geht es gerade NICHT – wie ein gern gepflegtes Missverständnis lautet –, um eine Fokussierung auf Städte und junge Leute (‚urbane Milieus’) o.ä.. Wer eine starke LINKE will, muss aufhören, über Milieus zu diskutieren und anfangen über Klassen zu reden und Politik für alle zu machen. Die Kämpfe für Emanzipation, gegen Ausbeutung und für die ökonomischen Interessen gehören zusammen. Auch die Einbindung einer sozialkonservativen Ansprache, die Sicherheit betont, in ein sozial-ökologisches Hegemonieprojekt kann dabei wichtig sein, um Mehrheiten zu erreichen. Aber Stephan Hebel brachte den nötigen Rahmen linker Politik in seinem Referat im Parteivorstand auf den Punkt: „Emanzipation ist unteilbar.“
Das Göttinger Institut für Demokratieforschung entwickelte 2016 die (auch in unserer Partei breit diskutierte) Überlegung, Mehrheiten links der Union könnten dagegen einfach als arbeitsteilige Addition der Wahlergebnisse von drei Parteien gewonnen werden, die jeweils nur „ihre“ Stammwähler ansprechen. Gerade Parteien, die wie DIE LINKE auch die Idee einer sozialistischen Gesellschaft erhalten, können aber nicht nur als Interessenvertretung einer kleinen gesellschaftlichen Gruppe funktionieren. Aus strategischen und inhaltlichen Gründen kann die LINKE nicht als Milieupartei oder identitätspolitisches Projekt funktionieren. Ihre unterschiedlichen Zugänge und Tonalitäten brauchen einen gemeinsamen strategischen Horizont.
Zudem folgt die Dynamik gesellschaftlicher Konflikte, Themensetzungen und elektoraler Mobilisierungen nicht einer mathematischen Additionslogik. Jeder Repräsentationsakt stellt sein Subjekt immer aktiv mit her. Unterschiedliche Ansprachen sind also wichtig, aber sie müssen auf ein gemeinsames Ziel hin orientieren. Das gilt auch für jede Partei einzeln. Es geht bei Wahlen schließlich auch immer um das Ganze.
Unser Vorschlag
1. Verbindliche Entscheidungen treffen: Wenn wir in der Lage sein wollen, von den absehbaren Legitimationsverlusten von Grünen und SPD während der Ampelzeit zu profitieren, müssen wir zum einen aufhören, widersprüchlich zu kommunizieren. Zugleich setzt erfolgreiche Opposition voraus, dass wir unserer Vorstellung vom Politikwechsel klären. Für den nächsten Parteitag schlagen wir daher programmatische Richtungsbeschlüsse zur Außenpolitik und zum sozial-ökologischen Umbau vor, die die bestehenden Fehlinterpretationen klären und die Rolle der LINKEN in der Welt des Jahres 2022 klarer bestimmen. Unser Vorschlag dafür ist: Als sozial-ökologische Zukunftspartei raus aus geopolitischer Blocklogik, menschenrechtlichen Doppelstandards und weg vom Dogmatismus – und hin zur selbstbewussten Perspektive einer sozial, ökologisch und multilateral orientierten EU, die sich unabhängig von der Blockkonfrontation zwischen den USA auf der einen und Russland/China auf der anderen Seite macht.
2. Programmatische Weiterentwicklung unserer Außenpolitik I: Alle in der LINKEN (und weite Teile der Gesellschaft) wollen eine De-Militarisierung der Außenpolitik. Die Bilanz des Militärischen bei der Lösung von internationalen Konflikten und humanitären Krisen ist katastrophal. Die LINKE muss daher an ihrer grundsätzlichen Kritik an militärischer Gewaltanwendung und Interventionspolitik festhalten. Sie sollte aber klar eine multilateral ausgerichtete Politik verfolgen, die die Spielräume internationaler Institutionen und existierender Vertrags- und Verhandlungssysteme nutzt und ausbaut. Zwar existieren Aufrüstung und asymmetrische Machtbeziehungen zwischen Staaten fraglos weiter, allerdings hat sich eine neue geopolitische Lage entwickelt. Die Rahmenbedingungen deutscher Außenpolitik haben sich signifikant verändert: Militärischen Interventionen haben sich als nicht erfolgreich erwiesen. Bündnisse wie die NATO sind aus diesen Erfahrungen geschwächt hervorgegangen. Bei den gegenwärtigen Konflikten, wie z.B. in Syrien, wurden kaum noch Rufe nach Interventionen laut. Die Friedens- und Außenpolitik der LINKEN benötigt vor diesem Hintergrund ein Update. Das wird in den kommenden vier Jahren eine zentrale Aufgabe und kann zu einem Alleinstellungsmerkmal gegenüber SPD und Grünen werden, deren Außen- und Sicherheitspolitik in vielerlei Hinsicht in den 1990er und 2000er Jahren und der Befürwortung „humanitärer Interventionen“ stecken geblieben ist.
3. Programmatische Weiterentwicklung unserer Außenpolitik II: Wir müssen Vorschläge machen, die nicht nur wünschenswert sind, sondern unseren sozialen Forderungen einen realistischen internationalen Ordnungsrahmen geben. Wir wissen, dass es einen großen Zuspruch in der Bevölkerung für unsere Friedenspolitik gibt. Beim Thema Außenpolitik gibt es dagegen eine Abwehrhaltung. Das klingt für uns zunächst unplausibel, weil wir Außenpolitik mit Friedenspolitik gleichsetzen. Doch wenn Wortmeldungen einzelner LINKER den Eindruck erwecken, in punkto Menschenrechte und Frieden würden wir mit zweierlei Maß messen, schadet das der Glaubwürdigkeit unserer Friedenspolitik. Zudem gibt es Klärungsbedarf: Die Passage zur Nato-Auflösung haben wir als klare Kritik am Militärbündnis angelegt. In der breiten Öffentlichkeit wird sie jedoch oft so verstanden, dass wir Deutschland außerhalb internationaler Bündnisse oder gar an die Seite Putins stellen wollen. Dieses Missverständnis müssen wir klären und deutlich machen: Wir stehen immer - ohne mit zweierlei Maß zu messen - für Abrüstung, Frieden, Menschenrechte und Völkerrecht ein.
4. Programmatische Weiterentwicklung der Europapolitik: Der Zeitplan für die Weiterentwicklung unserer Programmatik ist eng. Bereits bei den kommenden Europawahlen muss die Linke mit einer klaren europapolitischen Position bereitstehen. Denn jede erfolgreiche Mobilisierung setzt ein erreichbares Ziel voraus. Und ein Politikwechsel ist im Zentrum der EU ohne plausibles Konzept internationaler Politik heute nicht erreichbar. Das ewige „Jein“ zu Europa, was sich zuletzt hinter der Formel „Neustart“ verbarg, wird daher nicht mehr tragfähig sein. In der momentanen Lage können wir die EU nicht einfach „neu starten“. Wir können und sollten auch nicht für ihre Abschaffung votieren. Gleichwohl ist Kritik an der EU legitim. Schon angesichts der tödlichen Grenzpolitik verbietet sich eine unkritische Abfeierei. Gerade in Zeiten, in denen grundlegende Regeln in Europa sowieso zur Disposition stehen, entstehen aber auch Chancen für eine Politik, die sich nicht in abstrakten Grundsatzfragen verliert. Unser Vorschlag: Streiten wir gegen den sozialentkernten Liberalismus der Ampel für die Stärkung einer Europäische Union mit Perspektive, auf De-Militarisierung nach Außen, auf eine Humanisierung der Flüchtlingspolitik, auf eine Abschwächung der Macht- und Abhängigkeitsgefüge zwischen den Staaten, auf eine Ausweitung der Rechte des Europäischen Parlaments, auf eine grenzübergreifende Arbeitslosenversicherung, auf Mindeststeuern auf Vermögen und ein Ende der erpresserischen Wirtschafts- und Finanzpolitik.
5. Eine Parteireform im Zeichen von Kampagnen- und Handlungsfähigkeit: Es braucht in Abstimmung mit den Landesverbänden die Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur Stärkung der Partei vor Ort, zur Anbindung der Bundestagsfraktion und der MdBs und zur Einbindung der vielen Neumitglieder, die nach der Bundestagswahl eingetreten sind. Viele Mittel dafür sind bereits bekannt: Haustürwahlkampf, Organizing, Beteiligung an sozialen Bewegungen, offene Büros, Schulungen von Mitgliedern, Öffnung von Strukturen, etc.
6. Bewegen und verbinden: Im Umgang mit den aktiven Bewegungen gilt es Wunden zu heilen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Nur mit einem solidarischen Verhältnis zu den Aktiven für Klimagerechtigkeit, faire Mieten, bessere Arbeitsbedingungen und gegen Rassismus können wir wieder gewinnen. Neben unseren Bündnispartner*innen in Bewegungen, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft sollten wir uns ebenfalls Raum für eine offene Debatte mit unseren Mitgliedern nehmen. Die Botschaft: Zusammen können wir die LINKE als Zukunftspartei aufstellen. Gemeinsam können wir dieses Land verändern. Dieser Ansatz muss sich dann auch bald in der Arbeitsweise der Bundestagsfraktion widerspiegeln.
7. Unsere Funktion klar machen: Der halbierte Fortschritt im Koalitionsvertrag der Ampel zeigt, dass die Fragen, die wirklich etwas kosten, in der Politik des sogenannten „fortschrittlichen Zentrums“ (Olaf Scholz) hinten runter fallen werden. Keine der kommenden Regierungsparteien ist bereit, sich mit Reichen und Konzernen anzulegen. Wir schon. Aber Gerechtigkeit bedeutet mehr als Steuerentlastung für mittlere und niedrige Einkommen. Sie ist wie die Klimafrage eine Gattungsfrage. Unsere Funktion sollte daher sein, dass wir die Zukunftsfragen unserer Zeit - Gerechtigkeit, Klimawandel und Emanzipation - verbinden und diejenigen Gegner klar benennen, die die Zukunft blockieren. Gleichzeitig müssen wir den Kampf darum führen, dass die materielle Anerkennung derjenigen steigt, die trotz harter Arbeit - sei es in der Pflege, im Handwerk oder in der Bildung - kaum über die Runden kommen. Symbolische Anerkennung reicht nicht mehr.
8. Think big: Wir müssen die großen Fragen der Zeit - Gerechtigkeit und Klima - als Systemfrage stellen. Als einzige im Bundestag vertretene Partei, die eine Gesellschaft jenseits kapitalistischer Verwertungslogik anstrebt, dürfen wir uns nicht nur im Klein-Klein der Fachforderungen verlieren. Wir werden gewählt, weil wir weder Ausbeutung noch eine Vermögensverteilung akzeptieren, in der die oberen fünf Prozent so viel besitzen, wie die übrigen 95 Prozent, weil wir die Sorgen der Menschen in prekären Lebenslagen kennen und ihre Leistung wertschätzen. Wir werden gewählt, weil wir die Arbeitsverteilung zwischen den Geschlechtern und die Frage nach Arbeitszeitsverkürzung auf die Tagesordnung setzen. Wir werden gewählt, weil wir groß denken und alle wissen, dass wir entschlossen sind, jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Unser konkreter Ansatzpunkt für eine Kapitalismuskritik, jenseits der Überschriften, kann die Eigentumsfrage sein. Hier zeigt sich die Differenz zu Grünen und SPD deutlich, hier gibt es im Bereich der öffentlichen Grundversorgung (Wohnen, Gesundheit, ÖPNV, Energie) zahlreiche soziale Bewegungen. Hier können wir im Sinne einer Ausweitung Wirtschaftsdemokratie praktisch ansetzen.
Der Beitrag der Redaktionsmitglieder des Online-Magazins prager frühling Johanna Bussemer, Lena Saniye Güngör, Jan Schlemermeyer und Thomas Lohmeier erschien zuerst im prager frühling - magazin für freiheit und sozialismus.