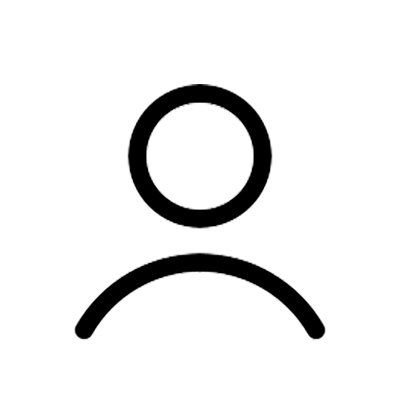Hoffnung allein ist keine Strategie
- flickr.com Dan Keck
Trotz des berechtigten Jubels über den Wahlsieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 lieferten die Demokraten in den USA bei den Wahlen zum US-Kongress erneut überraschend schlechte Ergebnisse.
Im US-Senat erkämpfte die Demokratische Partei lediglich einen Sitz mehr. Noch können sie darauf hoffen, dass sie eventuell doch noch die Mehrheit in dieser Kammer des US-Kongresses erringen. Dafür müssen sie jedoch am 5. Januar 2021 beide zur Wahl stehenden Sitze im US-Bundesstaat Georgia gewinnen. Diese Stichwahl wurde notwendig, weil am 3. November keine der Kandidat*innen die erforderliche 50 Prozent der Stimmen auf sich sammeln konnte.
Im Repräsentantenhaus dagegen hält die demokratische Mehrheit, aber nur noch mit einer verringerten Abgeordnetenzahl. Das ist besonders bitter. Denn Umfragen vor der Wahl deuteten vielmehr auf eine erweiterte Mehrheit für die Demokraten hin. Nun kommt es zum erneuten Streit zwischen Moderaten und Progressiven in der Demokratischen Partei über die Frage, wer an diesem Misserfolg schuld ist.
Den Moderaten zufolge seien es die radikalen Progressiven gewesen, die vielerorts den Wahlverlust der Demokratischen Partei verursachten. Sie behaupten, wegen des progressiven Flügels der Partei hätten die Wählenden in ihren Köpfen die ganze Partei mit „Sozialismus“ in Verbindung gebracht. Dadurch seien, so der Vorwurf, auch viele Kandidaten der Moderaten in den sogenannten „Swing Districts“ gescheitert, in Landkreisen also, in denen beide Parteien auf einen Wahlsieg hoffen können.
Progressive Politiker*innen, wie die mittlerweile weltweit bekannte Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) aus New York, antworten hingegen, das Problem habe nicht mit der Ideologie zu tun, sondern mit den schwachen Parteistrukturen und der daraus resultierenden fehlenden Unterstützung im Wahlkampf. AOC weiß, wovon sie spricht, denn sie selbst hatte bei den Vorwahlen im Jahr 2018 ihren Konkurrenten, den hochrangigen Abgeordneten Joe Crowley, besiegen können, weil ihm die Unterstützung der Parteiorganisation im Wahlkreis fehlte.
Die Demokratische Partei hat zwar eine große nationale Organisation, aber auf der lokalen Ebene keine dauerhafte Präsenz. Alle zwei bis vier Jahren müssen Aktivist*innen und parteinahe Gruppen erneut mobilisiert werden. Im Gegensatz dazu profitieren die Republikaner von ihren tieferen Wurzeln auf lokaler Ebene. Lokale republikanische Parteiorganisationen bekommen auch viel mehr Unterstützung von der Parteizentrale als ihre demokratischen Kontrahenten. Neben den Vorteilen, die das US-Wahlsystem in der Stimmgewichtung für Wähler*innen im ländlichen Raum schafft, ist das der Grund, warum die Republikaner in deutlich mehr Parlamenten in den einzelnen Bundesstaaten die Mehrheit auf ihrer Seite haben als die Demokraten. Wer diese Parlamente kontrolliert, darf auch die Grenzen der Wahlkreise ziehen und damit seine Macht befestigen. Das heißt, obwohl die Moderaten mit ihrem Argument, Sozialismus sei und bleibe ein politisch giftiger Begriff in den USA, recht haben mögen, weist AOC auf eine bessere, langfristige und nachhaltige Strategie hin.
Denn die progressive Politik, wenn auch nicht die progressiven Politiker*innen selbst, ist sehr populär und findet breite Unterstützung bei der Bevölkerung. So wünschen sich etwa zwei Drittel der US-Amerikaner eine allgemeine staatliche Krankenversicherung. Auch in erzkonservativen Bundesstaaten werden progressive Forderungen durchgesetzt – sei es durch Volksentscheide oder auch in republikanisch kontrollierten Parlamenten. US-Bundesstaaten wie Utah, Kentucky, West Virginia oder Arkansas haben Medicaid, wie die staatliche Krankenversicherung für finanzschwache Menschen genannt wird, erweitert. South Dakota hat kürzlich durch einen Volksentscheid Marihuana legalisiert. In Nebraska hat 2015 das Parlament das Veto des Gouverneurs überwunden und die Todesstrafe abgeschafft. Das bedeutet, dass Progressive Kandidat*innen auch in den konservativen Landesteilen kompetitiv sein können, wenn sie aus diesen Gegenden stammen und die gleiche Sprache sprechen, wie die Wählenden. Solange die Demokratische Partei ihre lokalen Strukturen nicht ausbaut, werden jedoch Sozialpolitik und „Sozialismus“ in den Köpfen der Wählenden fremde und gefährliche Begriffe bleiben.
Die Demokraten brauchen bei jeder Wahl eine massive Mobilisierung, um die strukturellen Vorteile der Republikaner zu überwinden. Ihr Erfolg ist stets von Erfolgswellen abhängig, die nur dann zustande kommen, wenn die Wählenden sich massenhaft gegen einen „Feind“, wie Trump, oder für Losungen, wie „Hoffnung und Wandel“, mobilisieren lassen. Ohne Investitionen in Parteistrukturen auf lokaler und Landesebene bleibt diese Mobilisierung schwer zu organisieren. Und Hoffnung allein ist keine Strategie.