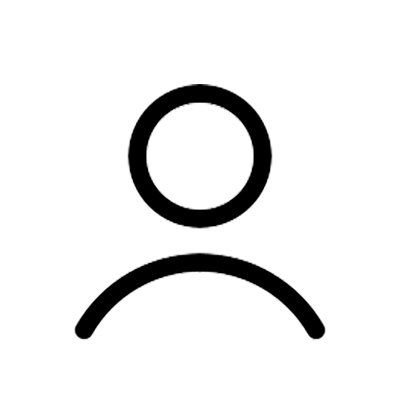Das Finanzsystem vom Kopf auf die Füße stellen
Am letzten Wochenende musste die Schweizer Regierung die taumelnde Großbank Credit Suisse retten. Sie hat dazu Staatsgarantien von 9 Mrd. Schweizer Franken auf den Tisch gelegt, damit die konkurrierende Großbank UBS die Credit Suisse übernimmt. In der Woche davor waren nach der Silikon-Valley-Bank noch weitere regionale Banken in den USA zusammengebrochen.
Alle Regierungen und Aufsichtsbehörden betonen, dass die Probleme von Silicon-Valley-Bank und Credit-Suisse Sonderfälle seien und davon für den „normalen“ Bankensektor keine Ansteckungsrisiken ausgehen. Das kann man glauben oder nicht. Die Realität ist aber doch eindeutig: Selbst wenn es wirklich nur Sonderfälle wären, bedroht die dadurch ausgelöste Vertrauenskrise längst den gesamten Finanzsektor. Wäre das alles nur ein Sturm im Wasserglas, müssten sich Regierungen und Zentralbanken nicht in Beschwichtigungen verunsicherter Einleger übertönen. Und die Schweizer Regierung hätte sich 9 Mrd. Franken sparen können.
Die Fast-Pleite der Credit-Suisse-Bank zeigt, dass es ohne starke Interventionen von Staaten und Zentralbanken im Finanzsektor bei Krisenfällen nicht geht. Das kann man bedauern, aber wohl kaum ändern. Nur der Staat – oder viele Staaten zusammen - haben im Krisenfall die Glaubwürdigkeit, sich gegen eine breite Vertrauenskrise im Finanzsektor zu stemmen.
Bei der Credit-Suisse kam die Bedrohung einmal mehr aus Verlusten aus dem Investment-Banking, u.a. aus spekulativen Engagements in Hedge-Fonds und aus Geschäften am Rande der Finanzkriminalität – oder darüber hinaus. Bei der Credit Suisse mögen die Missstände etwas augenfälliger und öffentlich bekannter gewesen sein. Es ist aber vollkommen naiv zu glauben, dass sie die einzige Großbank ist, bei der solche Missstände existieren.
Natürlich sollten große systemrelevante Finanzinstitute in Zukunft noch viel mehr Geld für ihre implizite „Staatsgarantie“ bezahlen und viel mehr Eigenkapital vorhalten. Das Prinzip „Bei Schönwetter werden die Bankgewinne privatisiert, und bei Krisen sorgt der Staat für Rettung“ muss endlich der Vergangenheit angehören.
Aber: Noch viel dringender als höhere Risikoprämien für systemrelevante Großbanken sind endlich harte Verbote für spekulative Bankgeschäfte. Der überwiegende Teil der heutigen Finanzmarktgeschäfte hat mit der Realwirtschaft nichts zu tun. Dieses sogenannte „Investment-Banking“ muss abgewickelt werden. Es macht Banker und vermögende Anleger bei schönem Wetter reich, und bei Gewitter tragen die Staaten, die Realwirtschaft und die Gesellschaft die Kosten.
Großbanken gehören nicht in private Hände und nicht unter das Prinzip der Gewinnmaximierung. Der Bankensektor insgesamt sollte eher als notwendige, öffentliche und möglichst gemeinwohlorientierte Infrastruktur verstanden werden, denn natürlich müssen Investitionen finanziert, Zahlungsströme abgewickelt und Ersparnisse sicher aufbewahrt werden. Die Sparkassen und Genossenschaftsbanken machen es vor: man kann mit seriösem Bankgeschäft vor Ort einen Beitrag für die Gesellschaft und die Realwirtschaft leisten, ohne im internationalen Finanzkasino mitzumischen. Durch die Institutssicherung garantieren die Sparkassen und Volks- und Raiffeisen-Banken zudem, dass sie sich gegenseitig stützen, statt bei Krisen dem Staat zur Last zu fallen. Auf diese Art von Bankenkultur muss der Bankensektor zurückgestutzt werden. Global tätige Großbanken mit spekulativem Investmentgeschäft sind hingegen herzlich verzichtbar.
Wer aber weiterhin glaubt, dass man Großbanken braucht, der muss nach dem Credit-Suisse-Fall mindestens eines einsehen: Jede Bank für sich und erst recht das gesamte Bankensystem sollte so hohe Eigenkapitalreserven haben, dass sie über jeden Zweifel erhaben sind. Man kann zwar bezweifeln, dass eine Bank jemals so viel Eigenkapital haben kann, dass dieses Niveau an Glaubwürdigkeit erreicht wird. Bei den derzeitigen Eigenkapitalquoten ist Vertrauen aber ganz offensichtlich nicht angebracht. Also müssen die Banken – insbesondere die großen international tätigen Banken - viel mehr Eigenkapital zurücklegen, statt Gewinne an Aktionäre auszuschütten. Für Großbank-Aktionäre gibt es für die nächsten zehn bis 20 Jahre sicher keine Spielräume für Dividenden. Vielleicht gibt es dann auch gar keine Großbank-Aktionäre mehr, denn wo keine Dividenden mehr sind, sind auch bald die Aktionäre auf und davon.
Bisher gilt auf den Finanzmärkten: Was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt. Als LINKE haben wir aus der Finanzkrise nach 2008 den Schluss gezogen, dass dieses Prinzip umgekehrt werden muss: Ähnlich wie bei Arzneimitteln sollten in Zukunft nur solche Finanzinstrumente und Finanzpraktiken erlaubt sein, die zuvor auf ihre Wirksamkeit und ein vertretbares Maß an »Risiken und Nebenwirkungen« für Staat und Gesellschaft geprüft wurden. Ein solches Zulassungsverfahren nennen wir „Finanz-TÜV“. Sehr viele der hochkomplexen Finanzwetten, über die heute erneut so manche Bank stolpert, würden den Finanz-TÜV nicht bestehen. Nach unseren Schätzungen wird dabei mehr als die Hälfte – vielleicht sogar Drei-Viertel – der Finanzinstrumente vom Markt verschwinden müssen. Die Vorgänge auf den Finanzmärkten müssen transparenter, nachvollziehbarer und langsamer werden, sonst kann man sich alle Pläne für eine ernsthafte Aufsicht über den Finanzsektor durch staatliche Behörden aus dem Kopf schlagen. Wir stehen weiterhin vor der Wahl: wollen wir ein Finanzsystem, das bei schönem Wetter wenige sehr reich macht und dessen Schäden bei Krisen wir alle bezahlen müssen. Oder wollen wir ein Finanzsystem, dass wir durch demokratische Kontrolle zähmen können und dass sich an den Bedürfnissen der Mehrheit der Menschen, der öffentlichen Hand und der Realwirtschaft orientiert. Unsere Antwort auf diese Frage ist klar. Die anderen Parteien machen entweder offensiv Politik für die Reichen oder eiern unentschlossen herum.