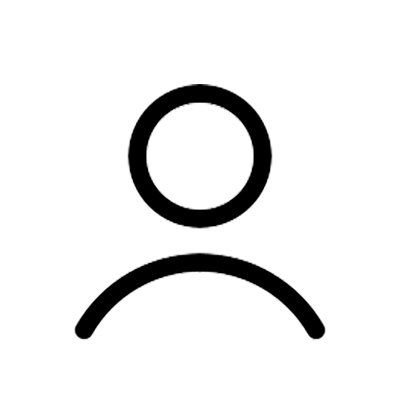Die Linkspartei muss sich für einen Weg entscheiden
Die Wahlniederlage war abzusehen und hat historische Gründe
Viel ist seit der Bundestagswahl über die Krise der Linkspartei geschrieben und gesagt worden. Klar ist, das desolate Wahlergebnis ist mehr als die Folge einer schlechten Wahlkampagne, ausbaufähiger Performance der Parlamentsfraktionen sowie eines nur schwerlich zu kommunizierenden Abstimmungsverhalten beim Afghanistan-Rettungseinsatz kurz vor der Bundestagswahl. Vielmehr hat der schleichende Niedergang, der in einem Ergebnis von 4,9 Prozent kumuliert ist, strukturelle Gründe, die zu lange vernachlässigt worden sind. Die These dieses Beitrags ist, dass die Partei aus diesen strukturellen Gründen Schlussfolgerungen ziehen und strategische Richtungsentscheidungen treffen muss, um ihr politisches Überleben zu sichern. Verharrt sie hingegen in ihrem Status Quo, ist der Untergang nur noch eine Frage der Zeit.
Drei strukturelle Gründe für den Niedergang der Partei scheinen dabei zentral: der Verlust der Wähler*innenbasis der Linkspartei im Osten, das Wiedererstarken der SPD, sowie die notorische Uneinigkeit der Partei in zentralen gesellschaftlichen Fragestellungen und ihre daraus resultierende inhaltliche Lähmung seit 2015. Bevor über die Zukunft der Partei gesprochen werden kann, sollen zunächst diese strukturellen Problemlagen beleuchtet werden.
Die Linkspartei und der Osten
Die PDS war eine ostdeutsche Regionalpartei, die passable Wahlerfolge aufgrund der Unzufriedenheit der Menschen mit dem neoliberalen Versuchsfeld „Neue Bundesländer“ erzielen konnte. In den Anfangsjahren der Linkspartei konnte die Partei auch auf Bundesebene von diesen Wahlergebnissen im Osten profitieren. Jedoch ist vom Status der Linkspartei als Volkspartei im Osten – mit Ausnahme von Thüringen – nicht mehr viel übrig. Holte die Partei bei der Bundestagswahl 2009 in Sachsen noch knapp 25 Prozent Zweitstimmen, waren es bei der Bundestagswahl 2021 nur noch 9,3 Prozent. In 12 Jahren hat die Linkspartei mehr als 60 Prozent ihrer Wähler*innenschaft verloren.
Auch wenn die Gründe vielfältig sind, ist doch ein Trend nicht zu verkennen: ein Großteil der ehemaligen Wähler*innen der Linkspartei ist schlicht nicht mehr am Leben. Und die Partei hat es über Jahre und beinahe Jahrzehnte verpasst, sich eine neue Wähler*innenbasis zu erarbeiten und diese langfristig an sich zu binden. Es war absehbar, dass die alten Wähler*innen kurz- bis mittelfristig keine Wahlerfolge der Partei mehr herbeiführen können und trotzdem wurde kaum etwas unternommen, neue Wege einzuschlagen. Stattdessen ruhte man sich auf dem Image der Kümmererpartei aus, ohne zu hinterfragen, ob diese Ausrichtung langfristig tragfähig und in jüngere Generationen vermittelbar ist. Wiederum mit Ausnahme von Thüringen verpasste es die Linkspartei, eine gesellschaftspolitische Vision ihrer Politik zu entwickeln und mit Bündnispartner*innen an deren Umsetzung zu arbeiten. Die Partei scheint im Osten mehr ein Wahlverein als ein gut vernetzter, parlamentarischer Arm eines sozialistischen Gesellschaftsprojekts zu sein. Das Resultat ist eine Partei, die im Osten im freien Fall ist und in der zumindest das Spitzenpersonal der ostdeutschen Landesverbände bisher nicht gewillt ist, den Niedergang aufzuhalten.
Eine anti-neoliberale Sammlungsbewegung
Die Lücke zur Etablierung einer gesamtdeutschen Linkspartei entstand durch die Agendapolitik unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. Neben ihrer Stärke im Osten konnte sich die Partei als glaubhafte anti-neoliberale „Sammlungsbewegung“ links der SPD etablieren. Damit erzielte sie in den späten Nullerjahren sowie den frühen 2010er-Jahren auch auf Bundesebene beachtliche Wahlerfolge. Davon ist spätestens seit dieser Bundestagswahl nichts mehr übrig.
Ein Grund hierfür ist die überraschende Wiederauferstehung der SPD. Diese erneuerte nicht nur ihre Führung und zeigte sich kampagnenfähig (ganz im Gegensatz zur Linkspartei) – sie kam mit einem durchaus vorzeigbaren sozialen Wahlprogramm um die Ecke. Sicherlich begünstigt durch einen desolaten CDU-Kandidaten Armin Laschet wurde die SPD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft. Aber auch die Linkspartei verlor rund 500.000 Wähler*innen an die SPD. Bei der Wahl zwischen 12 Euro Mindestlohn mit guter Durchsetzungsperspektive und 13 Euro Mindestlohn mit schlechter Durchsetzungsperspektive entscheiden sich viele Wähler*innen für Ersteres und damit für die SPD.
Im Koalitionsvertrag der Ampel ist von den vollmundigen Versprechen nicht viel übrig. Und dennoch bringt die erstarkte SPD die Linkspartei in eine akute Notlage. Es reicht für die Partei nicht mehr aus, eine bessere SPD zu sein und diese an ihr sozialdemokratisches Gewissen zu erinnern, um bei Wahlen erfolgreich zu sein. Neben den Verlusten der Partei in Ostdeutschland ist mit dem Erstarken der SPD die zweite tragende Säule vormaliger Wahlerfolge weggebrochen – mit bekanntem Ausgang.
Lähmung seit 2015
Dass die Wähler*innenbasis im Osten stirbt, war seit langem absehbar. Ebenso, dass das Image einer linken Korrektivpartei zur SPD immer weniger verfängt. Aber warum gelang es der Partei nicht, einen konsequenten und glaubwürdigen eigenen Weg einzuschlagen und eine eigenständige politische Vision zu entwickeln, die langfristig Wähler*innen bindet? Dies ist der dritte und vielleicht zentrale Grund für den aktuellen Niedergang der Linkspartei: die Partei konnte sich nie auf eine gemeinsame Erzählung einer gerechteren und besseren Welt einigen und nie ausbuchstabieren, was der oft propagierte demokratische Sozialismus konkret bedeutet. In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierungen seit 2015 wirkt dieses fehlende Leitbild toxisch: bei allen relevanten gesellschaftlichen Fragestellungen tritt die Partei mit unterschiedlichen und teils diametral entgegenstehenden Stimmen auf.
Zwar gelang es den vormaligen Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger, in zentralen politischen Fragen inhaltliche Klärungen herbeizuführen, jedoch wurden diese über Jahre hinweg von Teilen der Bundestagsfraktion unterlaufen. Anstatt die veränderten gesellschaftlichen Realitäten in eine gemeinsame Vision aufzulösen, verschlossen sich prominente Teile der Partei der dringend notwendigen Debatte. Gestützt wurde diese Weigerung durch ein inhaltsloses wahnwitziges Machtbündnis der Bundestagsfraktion seit 2015.
Die Folge war, dass die Linkspartei auf die großen gesellschaftlichen Fragen der vergangenen Jahre – ob nun Migration, Klimakatastrophe oder die Corona-Pandemie – keine einheitliche Antwort hatte. Vielmehr standen zwei unterschiedliche Positionen unversöhnlich gegenüber. Ein kleiner Teil der Partei setzt auf eine national-soziale Beantwortung globaler Verteilungsfragen und schreckt nicht davor zurück, populistische Forderungen der politischen Rechten zu übernehmen. Gleichzeitig wird von diesem kleinen Teil der Partei gefordert, ausschließlich die soziale Frage als Kernthema ins Zentrum der politischen Arbeit zu stellen. Als Bezugspunkt der Politik soll die klassenpolitische Konstellation der Wirtschaftswunderjahre in den 1950er- und 1960er-Jahren sowie die gesellschaftspolitischen Vorstellungen der damaligen Zeit dienen.
Der weitaus größere Teil der Partei setzt hingegen darauf, dass eine sozialistische Partei im 21. Jahrhundert neben dem sozialen Markenkern auch in Bereichen wie Klima-, Geschlechter-, und Migrationspolitik fortschrittliche Antworten haben und nach außen hin vertreten muss. Die Ausrichtung lässt sich wohl am besten als eine der unteilbaren internationalen Solidarität sowie der verbindenden Klassenpolitik in einer fragmentierten Arbeitsgesellschaft beschreiben. Dabei sollen die Menschen in ihren jeweiligen politischen Kämpfen unterstützt werden: egal, ob im Kampf gegen den Pflegenotstand, Verdrängung oder den Klimawandel.
Gelang es in den Anfangsjahren der Partei noch, die zwei grundlegend verschiedenen Politikansätze unter einem Dach zu vereinen, funktioniert diese Idee einer linken Sammlungsbewegung heute nicht mehr. Zu groß sind die inhaltlichen Differenzen, die seither einen unproduktiven und destruktiven Stillstand erzeugen. Quasi seit 2015 steht die Partei daher an einem Scheideweg und bewegt sich nicht vom Fleck. Während ein Großteil der Partei entschieden hat, welcher Weg einzuschlagen sei, weigert sich eine laute und „skurrile Minderheit“ in der Partei, dem in demokratischen Verfahren bestimmten Weg der Parteimehrheit zu folgen. Ganz im Gegenteil verharren sie im Glauben auf die absolute Wahrheit darauf, dass ihr Weg einer national-sozialen Linkspartei der einzig richtige sei. Je mehr Zeit vergeht, desto unversöhnlicher werden die verschiedenen Teile der Partei. Während die Linkspartei seit 2015 streitend an einer Weggabelung verharrt, hat sich die Gesellschaft und mit ihr die politische Landschaft beachtlich verändert. Um im Bild zu bleiben: Gesellschaft und politische Konkurrenz schritten voran, die Linkspartei blieb stehen. Das Resultat ist die Niederlage bei der Bundestagswahl. Bleibt die Partei weiter unentschlossen stehen, wird ihr Untergang die Folge sein. Will sie überleben, muss sie zeitnah und endgültig eine Entscheidung über den einzuschlagenden Weg treffen. Und alle müssen sich die Frage stellen, ob sie bereit sind, diesen Weg mitzugehen und persönliche Eitelkeiten hinten an zu stellen. Wer dies nicht kann, sollte den Hut nehmen und aufhören, die Partei zu lähmen.
Für eine ökosozialistische Vision – ein Neuanfang
Nach der endgültigen Entscheidung für einen Weg und nachdem etwaige Nachwehen politischer Scheidungen überwunden sind, muss die Partei sich daran machen, eine eigenständige, progressive und populäre sozialistische Vision zu erarbeiten. Die Partei war stets gut darin, den kapitalistischen Status Quo zu kritisieren, konnte aber kein gemeinsames Bild zeichnen, wofür sie eigentlich steht. Sie hat es bisher verpasst, eine eigenständige und lebensbejahende Erzählung einer besseren Gesellschaft zu entwickeln. Genau dies muss geändert werden. Die Partei muss zeigen, dass sie auch für etwas streiten kann und muss dabei ihre Vision einer besseren Gesellschaft ins Zentrum der Kommunikation stellen.
Angesichts der Klimakatastrophe und ihrer massiven Auswirkungen kann die Vision einer linken Partei nur eine ökosozialistische sein. Anstatt die Klimafrage als unwichtigen Nebenschauplatz abzutun und mantraartig zu wiederholen, dass die Linkspartei „nicht grüner als die Grünen“ sein darf, muss endlich die Dramatik der ökologischen Katastrophe erkannt werden und daraus eine konsequente linke Politikagenda im Angesicht des notwendigen radikalen gesellschaftlichen Wandels abgeleitet werden. Wir sehen doch immer wieder, dass die Kosten der Klimakrise nicht von den Verursacher*innen getragen, sondern vielmehr sozialisiert werden. Währenddessen werden die Gewinne des fossilen Kapitalismus weiterhin munter privatisiert. Eine Linkspartei auf der Höhe der Zeit muss dem konsequent entgegentreten und für eine Politik streiten, die gleichzeitig die ökologische Krise konsequent angeht und für eine Umverteilung von oben nach unten kämpft. Neben der sozialen Frage muss die ökologische Frage zum zweiten zentralen Markenkern der Partei werden. Das gebietet sowohl die Realität der Klimakrise als auch die zu erwartende neoliberale Klimapolitik der Ampel. Die Linkspartei muss zu der sozial-ökologischen Systemalternative werden. Das heißt aber auch, dass die Partei lernen muss, das Wort Klimagerechtigkeit auszubuchstabieren. Die Forderung nach kostenfreiem und ausgebautem ÖPNV ist gut, ist für die Menschen jedoch nicht greifbar. Wieso setzt die Linkspartei in einem Landkreis, in der sie in politischer Verantwortung ist, nicht ein Modellprojekt für kostenfreien und ausgebauten ÖPNV durch? Wieso unterstützt die Partei nicht die Errichtung von Bürger*innenenergieparks im ländlichen Raum und überzeugt die Menschen durch sinkende Stromrechnungen von den Vorteilen der Energiewende? Wieso veranstaltet sie keine Transformationskonferenzen und sammelt sowohl die Klimabewegung als auch die Beschäftigten der Automobilindustrie um sich, um mit ihnen über die industrielle Konversion und die Mobilität von morgen zu diskutieren? Dies wären erste Schritte für die konkrete Umsetzung ihrer sozial-ökologischen Utopie. Um zu einer wirklichen ökologischen Alternative zu werden, sind diese Schritte unerlässlich.
Darüber hinaus muss die Partei auch eine Neuausrichtung ihres sozialen Markenkerns vornehmen. Ein höherer Mindestlohn oder eine Vermögenssteuer sind zwar nette Forderungen, werden aber mittlerweile auch von anderen Parteien in ähnlicher Weise gefordert. Sie stellen nur kosmetische Korrekturen an einem dysfunktionalen kapitalistischen System dar und offenbaren noch keine Systemalternativen. Offensichtlich braucht Deutschland jedoch keine zweite sozialdemokratische Partei, sondern vielmehr eine konsequent sozialistische! Die Linkspartei muss sich daher wieder trauen, die großen Fragen zu stellen und nach Rosa Luxemburgs Motto der revolutionären Realpolitik zu beantworten: möglichst konkret, aber mit utopischem Überhang. Was bedeutet die Vision des demokratischen Sozialismus im Kleinen? Ein nahezu perfektes Beispiel stellt die Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ in Berlin dar. Hier wurde eine antikapitalistische Utopie konkret greifbar und die Frage zwischen Kapital und Menschen für jede*n ersichtlich zum Wohle der Menschen beantwortet. Genau solche Ideen muss die Partei weiterentwickeln und Beispiele, wie die Vergesellschaftung wichtiger Industriezweige unter Mitbestimmung der Arbeiter*innen, prominent thematisieren
Warum stellt sie dem modernen, entfesselten Finanzkapitalismus nicht die Idee eines Markt- und Infrastruktursozialismus entgegen? Dabei werden alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge in öffentliche Hand überführt und zum Wohle Aller, statt für die Profite Weniger geregelt. Krankenhäuser, Wohnungen und Verkehrsbetriebe sind in öffentlichem Eigentum und mit Milliardeninvestitionen wird ein tragfähiger und gerechter Sozialstaat aufgebaut. Sämtliche Bereiche der Daseinsvorsorge werden am Gemeinwohl und nicht nach Profitinteressen ausgerichtet. Weitere Bereiche der Wirtschaft werden in einem Modell des Marktsozialismus organisiert, das zwar Wettbewerb und Profite ermöglicht, letztere jedoch nicht unter Aktionär*innen, sondern unter den Beschäftigten aufgeteilt. Ob der richtige Name für ein solches Projekt nun der Green New Deal oder vielleicht ein anderer ist, sollte Gegenstand von weiterführenden Debatten sein. Zentral ist jedoch, dass die Linkspartei sich auf eine gemeinsame gesellschaftliche Vision einigt und diese geschlossen und entschlossen nach außen vertritt. Nur dann hat sie eine reelle Chance auf Neuanfang statt Untergang!