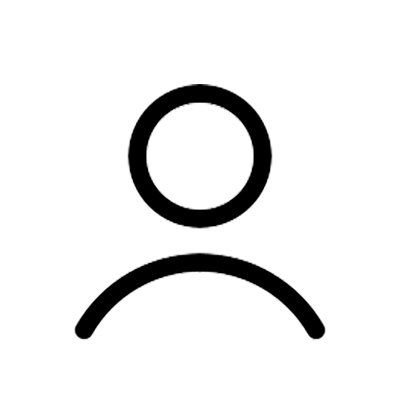Labour: Neuer Parteichef, neue Werte
Eine Zeitlang richteten sich die Augen vieler Linker in aller Welt auf die Insel, von der sich die neoliberale Thatcher-Revolution vierzig Jahre lang weltweit ausbreiten konnte, diesmal aber voller Hoffnung: Jeremy Corbyn, ein älterer Hinterbänkler vom linken Labour-Flügel, der bis dahin vor allem als Gegner bewaffneter Interventionen und Apartheid und Unterstützer von nationalen Befreiungsbewegungen, Abrüstung und Arbeiter*innenrechten bekannt war, wurde überraschend Parteivorsitzender von Labour, dieser großen, altehrwürdigen Volkspartei. Noch überraschender: Er schien mit einem neuen Bündnis aus Arbeiterschaft und jungen urbanen Akademiker*innen-Schichten den Weg zu weisen, wie Linke nicht nur das Techtelmechtel der britischen Labour-Partei mit dem Neoliberalismus beenden, sondern auch Mehrheiten gewinnen könnten. Der Slogan „für die vielen, nicht die wenigen“ zündete bei zahlreichen jungen Menschen, die sich politisierten und zu Zehntausenden Parteimitglieder wurden. Forderungen, die seit Jahrzehnten nicht mehr in die Mitte der politischen Diskussion gehörten, wurden auf einmal mehrheitsfähig: nach radikaler sozialer und wirtschaftlicher Teilhabe, vor allem der unteren Schichten, nach höheren Steuern für die Reichen sowie massiven staatlichen Investitionen, vor allem im abgehängten Norden des Landes, oder nach kostenfreien und solide finanzierten öffentlichen Gütern wie schnelles Internet, Gesundheit, Transport und Bildung. Getragen auf dieser Welle konnte Labours progressives Programm 2017 gut 40 Prozent der Wählerschaft gewinnen, eine Mehrheit schien zum Greifen nahe.
Dem Aufbruch folgte ein tiefer Fall
Dem hellen Aufbruch folgte der tiefe Fall. Bei den Wahlen 2019, die von Fragen des Brexit geprägt waren, konnte der konservative Populist Boris Johnson einen erdrutschartigen Sieg erringen. Die vernichtende Niederlage führte nicht nur zum Abtritt Corbyns, sondern auch die politische Richtung, Corbynismus genannt, steht insgesamt zur Disposition. Diese Frage ist nicht neu. Labour wurde zwar vor 120 Jahren von Sozialist*innen gegründet, sollte aber nie eine sozialistische Partei sein, sondern eine Partei der Arbeiterbewegung, die mit den Gewerkschaften nach wie vor auf eine institutionelle Weise verflochten bleibt, wie wir es uns in Deutschland kaum vorstellen können. In dieser breiten Volkspartei gab es schon immer Menschen, die die bestehende kapitalistische Gesellschaft bejahten, diese aber verbessern und sozial abfedern wollten. Für andere war sie eine Reformpartei, die den Kapitalismus durch schrittweise Sozialreformen ersetzen soll, während andere wiederum sich für einen transformativen, gar revolutionären Umsturz des bestehenden Wirtschafts- und Sozialsystems einsetzten. Ähnlich breit aufgestellt ist die Partei, wenn es um Fragen der Außenpolitik oder der kulturellen und gesellschaftlichen Ausrichtung der Partei angeht.
In dieser Gemengelage kommt dem neuen Parteivorsitzenden Keir Starmer eine ausschlaggebende Rolle zu. Und seine absolute Priorität steht fest: die nächsten Wahlen gewinnen. Um dies zu erreichen, greift er den chaotisch regierenden Premier Johnson auf staatstragende und überzeugende Weise an, lässt die Partei geschlossener auftreten und hat Corbyn aus der Partei zeitweilig suspendiert, um einer toxischen Debatte um vermeintlichen wie tatsächlichen Antisemitismus in der Partei ein Ende zu bereiten. Vielleicht noch wichtiger: Starmer geht davon aus, dass Labour nur dann gewinnen und vor allem die nordenglischen Stammwähler*innen aus der Arbeiterschaft zurückholen kann, wenn sie keine Angriffsflächen für die Mobilisierung aggressiver populistischer Ressentiments für einen neuen Kulturkampf bietet, den Labour wahrscheinlich, wie schon in der Brexit-Frage nur verlieren würde. In der Folge gehören Nation, Patriotismus, Familienwerte sowie Recht und Ordnung wieder zum Wertekanon der Partei, während es zu einer Distanzierung gegenüber linkem Aktivismus kommt, etwa der antirassistischen «Black Lives Matter»-Bewegung.
Der neue Vorsitzende hält an Corbyns Sozialpolitik fest
Damit nimmt Starmer einen Konflikt mit vielen Parteilinken, vor allem den jungen und urbanen Aktivist*innen in Kauf. Viele von ihnen finden die Wendung nicht nur politisch falsch, sondern fragen sich auch, ob es politisch sinnvoll ist, Wähler*innen nach dem Mund zu reden oder ob sich diese bei den Wahlen nicht trotzdem für das konservative Original entscheiden würden.
Da Starmer sich aber nach wie vor der linken Sozial- und Wirtschaftspolitik seines Vorgängers verpflichtet zeigt und sich offen Sozialist nennt, ist es bislang nicht zu einem Bruch gekommen. Das ist wahrscheinlich auch gut so: Die britische Linke hat aufgrund des Parteiensystems keine Alternative zu Labour, und sie darf es den Parteirechten nicht leichtmachen, unnötig viel Einfluss auf die Partei zu nehmen. Sie haben auch noch einige Trümpfe in der Hand: Die Ideen der Linken bestimmen nach wie vor die politische Debatte, sie hat eine beträchtliche Präsenz an der Basis und ist in der Parlamentsfraktion so stark wie zu keinem Zeitpunkt seit den 1980er Jahren vertreten, was ihr bei einem etwaigen Sieg Labours eine starke Verhandlungsposition bescheren würde.